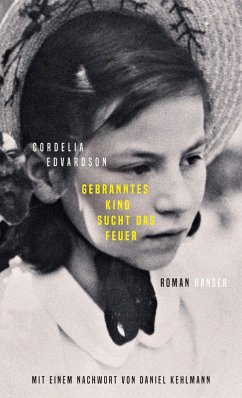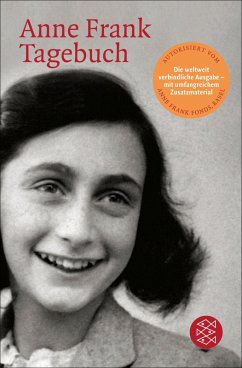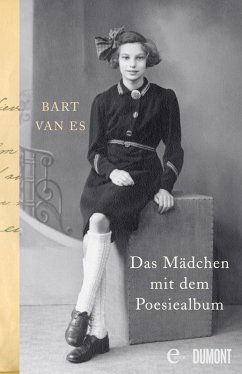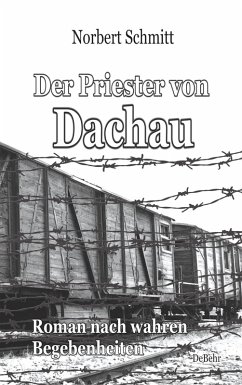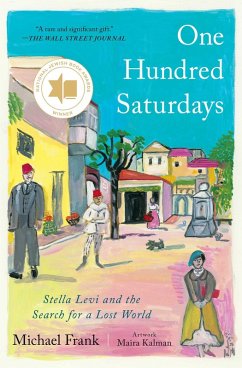Und du bist nicht zurückgekommen (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 10,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Marceline ist fünfzehn, als sie zusammen mit ihrem Vater ins Lager kommt. Sie nach Birkenau, er nach Auschwitz. Sie überlebt, er nicht. Siebzig Jahre später schreibt sie ihm einen Brief, den er niemals lesen wird. Einen Brief, in dem sie das Unaussprechliche zu sagen versucht: Nur drei Kilometer sind sie voneinander entfernt, zwischen ihnen die Gaskammern, der Hass, die ständige Ungewissheit, was geschieht mit dem anderen? Einmal gelingt es dem Vater, ihr eine kleine Botschaft auf einem Zettel zu übermitteln. Aber sie vergisst die Worte sofort - und wird ein Leben lang versuchen, die zerb...
Marceline ist fünfzehn, als sie zusammen mit ihrem Vater ins Lager kommt. Sie nach Birkenau, er nach Auschwitz. Sie überlebt, er nicht. Siebzig Jahre später schreibt sie ihm einen Brief, den er niemals lesen wird. Einen Brief, in dem sie das Unaussprechliche zu sagen versucht: Nur drei Kilometer sind sie voneinander entfernt, zwischen ihnen die Gaskammern, der Hass, die ständige Ungewissheit, was geschieht mit dem anderen? Einmal gelingt es dem Vater, ihr eine kleine Botschaft auf einem Zettel zu übermitteln. Aber sie vergisst die Worte sofort - und wird ein Leben lang versuchen, die zerbrochene Erinnerung wieder zusammenzufügen. Marceline Loridan-Ivens schreibt über diese Ereignisse und über ihre unmögliche Heimkehr, sie schreibt über ihr Leben nach dem Tod, das gebrochene Weiterleben in einer Welt, die nichts von dem hören will, was sie erfahren und erlitten hat. Und über das allmähliche Gewahrwerden, dass die Familie ihren Vater dringender gebraucht hätte als sie: »Mein Leben gegen deines.« Und du bist nicht zurückgekommen ist eine herzzerreißende Liebeserklärung, ein erzählerisches Meisterwerk, ein einzigartiges Zeugnis von eindringlicher moralischer Klarheit - das wohl letzte Zeugnis seiner Art.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.de87 Jahre alt musste Marceline Loridan-Ivens werden, um über den Tod ihres Vaters in Auschwitz schreiben zu können. Sie hat den Holocaust im KZ Birkenau überlebt. Was ihr geblieben ist, ist ein Brief, eine Botschaft ihres Vaters kurz vor seiner Ermordung. Ihr Überleben hat ihr keinen Frieden gegeben. Das Leben als Überlebende mündete in Schweigen und Einsamkeit. Sieben Jahrzehnte brauchte Marceline, um ihrem Vater zu klagen, dass er nicht zurückgekommen sei. Diesem Buch ist es zu wünschen, dass es nach Frankreich auch in Deutschland für Furore sorgt. Dass es uns wachrüttelt, uns den nationalsozialistischen Terror nicht vergessen lässt, den Zweiten Weltkrieg, Ausgrenzung, Rassismus, Massenvernichtung, Tod und Elend. Iris Berben liest eindringlich, ergreifend - und stellt das Wichtige in den Vordergrund: Marcelines Hommage an ihren Vater und ihre tiefe Trauer. Die Verletzlichkeit, die Tragik, die Sehnsucht nach dem Vater, der mehr sein muss als die Erinnerung an einen kurzen Brief - all das schimmert durch. Iris Berbens Zurückhaltung zeigt, welch intelligente Interpretin und welche große Künstlerin sie ist.
buecher-magazin.de87 Jahre alt musste Marceline Loridan-Ivens werden, um über den Tod ihres Vaters in Auschwitz schreiben zu können. Sie hat den Holocaust im KZ Birkenau überlebt. Was ihr geblieben ist, ist ein Brief, eine Botschaft ihres Vaters kurz vor seiner Ermordung. Ihr Überleben hat ihr keinen Frieden gegeben. Das Leben als Überlebende mündete in Schweigen und Einsamkeit. Sieben Jahrzehnte brauchte Marceline, um ihrem Vater zu klagen, dass er nicht zurückgekommen sei. Diesem Buch ist es zu wünschen, dass es nach Frankreich auch in Deutschland für Furore sorgt. Dass es uns wachrüttelt, uns den nationalsozialistischen Terror nicht vergessen lässt, den Zweiten Weltkrieg, Ausgrenzung, Rassismus, Massenvernichtung, Tod und Elend. Iris Berben liest eindringlich, ergreifend - und stellt das Wichtige in den Vordergrund: Marcelines Hommage an ihren Vater und ihre tiefe Trauer. Die Verletzlichkeit, die Tragik, die Sehnsucht nach dem Vater, der mehr sein muss als die Erinnerung an einen kurzen Brief - all das schimmert durch. Iris Berbens Zurückhaltung zeigt, welch intelligente Interpretin und welche große Künstlerin sie ist.