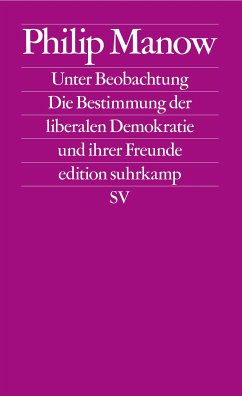Philip Manow skizziert eine mit der jüngsten Entwicklung der politischen Institutionen sowie der dadurch ausgelösten Krise systematisch verwobene Begriffsgeschichte unserer demokratischen Gegenwart. Dabei deutet der Politikwissenschaftler die derzeitige Krise als Konsequenz der Epochenschwelle von 1989/90. Generell zeigt sich: Unsere Ontologien sind immer historisch und deswegen auch immer politisch. Dies gilt im Besonderen, wenn es sich um Ontologien des Politischen handelt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Populistische Herausforderungen in anderem Licht: Für Philip Manow hat eine bestimmte Form liberaler Demokratie ihre oft beklagte Krise selbst produziert
Die Populisten bekämpfen die liberale Demokratie - so will es die Beobachtung liberaler Demokraten. Aber lässt sich überhaupt verstehen, was Populismus ist, wenn man nicht verstanden hat, was "liberale Demokratie" bedeutet? Diese Frage ist die Achse, um die sich "Unter Beobachtung" dreht, das neue Buch des Politikwissenschaftlers Philip Manow. Sie provoziert, weil sich der Autor wenig interessiert für die heroischen Ideale und ewigen Werte, die man üblicherweise anführt, um die populistische Gefahr zu beschwören. "Liberale Demokratie" ist für Manow eine konkrete, relativ neue Herrschaftsform. Und wer ihre Krise erklären will, muss verstehen, wem sie Macht verleiht - und wer in ihr das Nachsehen hat.
Der jüngst als Professor für Internationale Politische Ökonomie von Bremen nach Siegen gewechselte Autor setzt mit dieser Perspektivumkehr seine vorangegangenen Überlegungen fort. 2018 hatte er sich mit den wirtschaftlichen Entstehungsbedingungen links- und rechtspopulistischer Parteien in Süd- und Nordeuropa befasst, wo unterschiedliche Formen migrationspolitischer und ökonomischer Globalisierung jeweils verschiedene Forderungen nach Schließung hervorgebracht haben. Dass sich die infolgedessen entzündete Angst vor dem Untergang der Demokratie daraus erklären lässt, dass in den Medien und Parteien eine Vielzahl von Filtermechanismen und Gatekeepern weggefallen ist, und damit also die Möglichkeit, diese Forderungen einzuhegen, bildete die Hauptthese des darauffolgenden Buchessays. Aber auch hier blieben Fragen offen: Wieso prägt sich diese neue populistische Konfliktlinie so unversöhnlich aus? Wieso lässt sie sich nicht ohne Weiteres in die hergebrachten Formen parlamentarischen Parteienwettbewerbs einfügen, wie es etwa mit den Grünen gelungen ist?
Auf diese Fragen verspricht das neue Buch eine Antwort: Jene "liberale Demokratie", die in die Krise geraten ist, weil ihr in vielen Ländern eine neue populistische Fundamentalopposition entgegenschlägt, hat diesen Backlash selbst produziert. Seit den Neunzigerjahren, so Manows These, wurde der politische Raum in einem ungekannten Ausmaß verrechtlicht und konstitutionalisiert. Viele westeuropäische Länder führten Verfassungsgerichte ein und statteten sie mit der Kompetenz zur Kontrolle der parlamentarischen Gesetzgebung aus. Insbesondere in Osteuropa, wo man sich nach dem Untergang des Sozialismus an dem bundesrepublikanischen Modell starker Verfassungsgerichtsbarkeit orientierte, erlebte die Judikative ungekannte Machtgewinne. Und diese Macht blieb - so Manows Schilderung - nicht ungenutzt. Um den ersehnten Beitritt zur Europäischen Union voranzutreiben und schließlich abzusichern, entwickelte sich etwa in Ungarn ein regelrechter Richteraktivismus: "Mithilfe des Rechts und der Aufsicht über das Recht durch Verfassungsgerichte versuchen diese Transformationsgesellschaften ihre Übergangsprozesse zu entpolitisieren und zu verregeln, ihnen somit Irreversibilität und Berechenbarkeit zu verleihen."
Verstärkt wird dieses Problem dadurch, dass die EU in ihren Verträgen eine Vielzahl ökonomischer und rechtlicher Bestimmungen absichert, die unter dem Erfordernis von Einstimmigkeit bei Vertragsänderungen quasi politisch sakrosankt sind. Dieser Umstand nimmt schließlich auch dem Europäischen Gerichtshof jede Scheu, sein Mandat exzessiv auszulegen und die "Integration durch Recht" auszuweiten und zu intensivieren - immerhin muss er schwerlich befürchten, von politischer Seite in die Grenzen gewiesen zu werden.
Diese Konstellation treibt irgendwann die Frage hervor: "Wer schützt eigentlich die Politik vor dem Recht?" Im Pathos des Menschenrechtsdiskurses und der allgemeinen Vorliebe für die vier Freiheiten des Binnenmarktes konnte man, so Manow, die Tatsache, "dass eine Aufwertung der Gerichte" zwangsläufig "mit einer Abwertung der Parlamente einhergeht" und damit "mit einer Abwertung der demokratischen Wahl", leicht vergessen. Doch diese Abwertung macht sich schließlich bemerkbar: Wenn der Raum des Politischen immer weiter zusammenschrumpft, können auch bestimmte neue politische Forderungen nicht parlamentarisch ausgetragen werden - und werden stattdessen in die Fundamentalopposition getrieben.
Diese Dialektik von Verrechtlichung und Radikalisierung ist überaus einleuchtend; ihr Gegenbild ist die integrative Kraft offen ausgetragener politischer Konflikte. Gerade deswegen ist es aber bedauerlich, dass das Buch nicht ausführlich darauf eingeht, welche konkreten Verrechtlichungen und Konstitutionalisierung als besonders problematisch gelten müssen - und wieso sie erst in jüngster Zeit die Kraft haben, ein Fünftel bis ein Drittel des Elektorats gegen die politischen Eliten zu mobilisieren. Man fragt sich schließlich, ob das beschriebene Entpolitisierungsproblem nicht noch über Rechtsfragen hinausreicht: Ist nicht auch die ungemein gestiegene internationale Kapitalmobilität ein wirksamer Bürge dafür, dass bestimmte politische Optionen als faktisch undenkbar gelten? Dass die allgemeine Globalisierungseuphorie in den Neunzigerjahren und das bis heute wirksame Dogma, es handle sich um einen eigentlich unumkehrbaren Prozess, ihren Teil zur Einbetonierung einer bestimmten Zukunftsvorstellung beigetragen haben, wird immerhin angedeutet.
Die im Buch geschilderten empirischen Beobachtungen sind für sich genommen nicht neu: Schon länger gibt es in der Rechts- und Politikwissenschaft Diskussionen zur Frage, ob es nach dreißig Jahren Konstitutionalisierung und Verrechtlichung auch zu viel Judikatur, zu mächtige Verfassungsgerichte geben kann. Ausgesprochen originell ist aber, wie Manow diese Entwicklung mit den Beobachtungsroutinen der politischen Öffentlichkeit verknüpft. "Liberale Demokratie", so die Pointe des Buches, ist kein Konzept, das sich aus universalen Prinzipien deduzieren ließe und nun im Grunde unverständlichen Anfeindungen ausgesetzt ist - wie es eine geläufige Entlastungserzählung will. Es handelt sich vielmehr um ein recht junges, konkretes institutionelles Phänomen, das - gerade in der EU - Stück für Stück Dinge vom politischen Tableau hat verschwinden lassen, um sie der Aufsicht wohlmeinender Richter zu übergeben. Der Populismus ist für Manow folglich "nicht der Gegner, sondern das Gespenst der liberalen Demokratie" - er ist der Wiedergänger der von ihr erstickten Politik.
In dieser Perspektive erscheinen auch die allgemeinen Warnungen vor dem Untergang der Demokratie in einem anderen Licht. Augenfällig wird, dass die meisten von ihnen sich um eine ganz bestimmte, liberale Variante derselben sorgen. "Die einen sagen Demokratie und meinen Volkssouveränität, die anderen sagen Demokratie und meinen Gewaltenteilung." Weil man sich im demokratischen "Wertehimmel" aber nicht für den gewandelten institutionell-rechtlichen Körper der jeweiligen politischen Systeme interessiert, bleibt diese Besonderheit dem eigenen Urteil verborgen. Viele Krisendiagnosen sind deshalb eigentlich keine: Sie konstatieren bloß, dass dummerweise im rechten politischen Spektrum (und manchmal auch im linken) ein Gegner herangewachsen ist, der bekämpft werden muss. Was das mit der liberalen Demokratie selbst zu tun haben könnte, bleibt außerhalb des Horizonts oder scheint nur am Rande auf. Viele um die Gegenwart besorgte Bücher enden deshalb nicht selten mit der Forderung, "dass die richtigen Werte halt noch intensiver gelebt und noch nachdrücklicher vermittelt werden müssen".
Was wäre dagegen die Konsequenz von Philip Manows Beobachtungen? Das Buch hält sich mit praktischen Folgerungen fast vollständig zurück. Eine Entkonstitutionalisierung des Europarechts scheint in weiter Ferne zu liegen. In Deutschland weigert sich die Union bislang, die fiskalischen Grenzen, die die Schuldenbremse setzt, auch nur zu diskutieren. Vielleicht wäre aber schon etwas erreicht, wenn der Provokationscharakter von Manows Thesen die demokratische Öffentlichkeit nicht davon abhielte, die angebotene Perspektive versuchsweise zu übernehmen und zumindest ergänzend von Feindbeobachtung auf Selbstbeobachtung umzustellen. Vielleicht lernt man auf diesem Wege, wie man überhaupt zum Feind seines Feindes hat werden können. OLIVER WEBER
Philip Manow: "Unter Beobachtung". Die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde.
Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 2024. 252 S., br., 18,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.