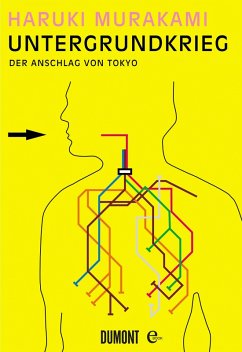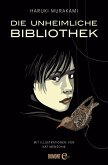Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Interviews mit Vergifteten: Haruki Murakami dokumentiert den Gas-Anschlag der Aum-Sekte
Am 20. März 1995 legten Mitglieder der japanischen Aum-Sekte in fünf Tokioer U-Bahn-Linien saringefüllte Beutel aus und durchstachen sie mit einem spitzen Regenschirm, bevor sie die Züge verließen. Regenschirme konnten an diesem Tag an sich schon Verdacht erregen, denn der Himmel war strahlend blau. Doch niemand kam auf die Idee, seine Mitpassagiere zu mustern.
Der klassische Tokioer Pendler steht gegen sechs Uhr auf, nimmt eine mit mehrmaligem Umsteigen verbundene, oft zweistündige Anfahrt zum Arbeitsplatz in Kauf und folgt dem Usus, lieber eine Stunde zu früh im Büro zu sein, nicht zuletzt, um die rituelle Morgenbegrüßung nicht zu versäumen. Der morgendliche U-Bahn-Benutzer ist ein diszipliniertes Wesen, das sich in mehreren Reihen vor den immer gleichen Zugtüren anstellt, die Augen schließt, wenn die Massen ihn wie ein Sandwich zusammenpressen, und in Schlaf verfällt, sobald er einen Sitzplatz findet. Er war das ideale Opfer für das "Armageddon" der Weltuntergangssekte. Ein Jahr zuvor hatte Aum dasselbe Giftgas mit einem Sprühwagen im Freien verteilt und so sieben Menschen umgebracht und Hunderte verletzt. Doch erst der Anschlag auf die unterirdischen Transportwege brachte das vom Sektenführer Shoko Asahara erwünschte Desaster hervor.
Kontrolliert auf allen vieren
"Untergrundkrieg", eine Interviewsammlung des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami, gibt einen packenden Einblick in die sich langsam entfaltende Katastrophe. Die Züge, in denen die Sarin-Beutel lagen, fuhren stundenlang ungehindert weiter, der Fahrtwind entgegenkommender Züge verteilte das Gas in den Stationen. Die ahnungslosen Bahnbeamten entsorgten die suspekte Flüssigkeit mit den Händen, verstauten sie bestenfalls in offenen Plastiksäcken, die in den Schächten stehenblieben. Die Augenzeugen berichten von einer stummen Panik in den Zügen: als der schlechte Geruch sich verbreitet, die Mitreisenden zu husten beginnen, einzelne umfallen oder auf ihrem Sitz zusammensinken, wechseln Entschlossene den Wagen, andere freuen sich über die frei werdenden Plätze und harren aus. Gespenstisch ist der Kommunikationsmangel unter den Betroffenen.
Die Reisenden führen die Beschwerden auf den permanenten Streß zurück, dem sie ausgesetzt sind; da Zusammenbrüche keine Seltenheit scheinen, ignorieren sie auch die ersten Opfer. Plötzlich eskaliert die Situation, das Insektizid fällt die Menschen "wie die Fliegen". Sie stürzen aus den sich öffnenden Türen, krümmen sich auf dem Bahnsteig mit Schaum vor dem Mund oder schleppen sich noch ein paar Treppen hinauf, sofern der entgegenkommende Menschenstrom ihnen dazu Raum läßt. Wer es an die frische Luft schafft, muß feststellen, daß sie ihm keine Erleichterung bringt. Der Himmel hat sich nun tatsächlich verdunkelt, doch es ist kein Regen, sondern eine Erblindungserscheinung. Jedes Opfer erlebt die Vergiftungssymptome anders, ihnen gemein ist der Versuch, sie herunterzuspielen. Viele nehmen sich ein Taxi, um doch noch ins Büro zu kommen, einige kriechen auf allen vieren weiter.
So bescheiden Murakami seine Absicht formuliert, abseits von der Sensationspresse eine Anschauung davon zu gewinnen, was an diesem höllischen Morgen wirklich geschah, so brisant sind seine Ergebnisse. Bezeichnenderweise waren von 3800 Geschädigten nur sechzig, also kaum zwei Prozent, zu einem Gespräch bereit. Das Bedürfnis, Gras über die Angelegenheit wachsen zu lassen, ist auf allen Seiten groß. Die dennoch gewonnenen Berichte geben einen bizarren Eindruck von der kompletten Hilflosigkeit der öffentlichen Stellen, von einem Gesundheitsamt, das telefonisch nicht zu erreichen ist, gelähmten Polizeibehörden, einer nicht besetzten Feuerwehr und einem miserabel koordinierten Krankenwageneinsatz. Nur die Medien sind unfehlbar schnell am Platze und müssen von verzweifelten Helfern dazu überredet werden, ihre Busse zum Krankentransport herzugeben.
Der vierten Gewalt im Staat war es zu verdanken, daß überhaupt eine Verständigung über die Krise zustande kam, erste Informationen die Bevölkerung erreichten und die Zahl der Toten schließlich nicht über elf hinausging. Krankenhäuser schickten Erblindete zunächst mit der Begründung von dannen, sie seien keine Augenpraxen, Schwervergiftete mußten vor der Notaufnahme warten, es dauerte Stunden, bis die Sarin-Diagnose sich herumgesprochen hatte - und auch das ist auf einzelne Ärzte zurückzuführen, die die Initiative ergriffen und ihre Kollegen per Fax über Gegenmittel informierten. Zu den gesundheitsschädigenden Folgen trug nicht zuletzt bei, daß die Verseuchten unbelehrt ihre Kleider anbehielten.
Murakamis Studie bringt die Konsequenzen einer fehlenden Krisenzentrale und Katastrophenlogistik erbarmungslos an den Tag. Nicht nur der erste Sarin-Anschlag, auch das jüngste Erdbeben in Kobe hatte keine präventiven Maßnahmen gezeitigt. Symptomatisch erscheint in diesem Zusammenhang, daß eine der betroffenen U-Bahn-Stationen direkt an einem von Ministerien gesäumten Platz lag - und doch niemand zu Hilfe eilte: "Nicht einmal ein Taxi haben sie gerufen." Zugleich zeigt "Untergrundkrieg", daß die Schuld nicht allein bei den Behörden zu suchen ist: "Alle gingen weiter, als gingen wir sie nichts an", berichtet eine Frau aus der Opferperspektive am U-Bahn-Eingang. "Es saßen zwar eine ganze Menge Leute um mich herum, aber geredet habe ich eigentlich mit keinem", erinnert sich ein anderer an die Szene auf dem Asphalt.
Es ist nicht selten, daß plötzliche Katastrophen von Inkompetenz und Kopflosigkeit begleitet werden. Doch in der hier geschilderten Apathie scheint sich ein mentalitätsbedingter Faktor zu verraten: "Niemand sagte etwas. Keine Reaktion, keinerlei Kommunikation", erzählt ein Fahrgast: "Ich habe ein Jahr in Amerika gelebt. Wenn das gleiche in Amerika passiert wäre, hätte es einen Riesenaufruhr gegeben." Die von Murakamis Buch gezeichnete japanische Gesellschaft ist stark funktionalistisch und in geschlossenen Systemen organisiert. Ausfälle sind nicht vorgesehen, der einzelne ist ein verläßliches Rädchen, das pflichtbewußt, zielstrebig und duldsam seinen Aufgaben nachgeht. Weder Desinteresse noch Egoismus und humane Kälte scheinen daher den mangelnden Beistand verschuldet zu haben. Der Grund ist im Gegenteil eher in der Selbstlosigkeit des japanischen Angestellten und in seinem starken Verantwortungsbewußtsein dem Arbeitsplatz gegenüber zu suchen, der als familiengleiche Bindung gepflegt und empfunden wird.
Die Eltern der Sarin-Opfer waren nicht selten einfache Leute vom Lande, an denen die traditionellen japanischen Werte noch ungetrübt zu studieren sind. Auffällig in Murakamis Gesprächen mit ihnen ist das Bedürfnis, selbst noch dem Tod gegenüber die Fassung zu bewahren, die Haltung nicht zu verlieren, die Gefühle zu kontrollieren. Darin steckt Rücksichtnahme auf den anderen, die Scheu, sich aufzudrängen und wichtig zu machen. Die Kehrseite dieses ehrenwerten Ethos ist ein problematisches Phlegma, das die Verantwortung delegiert und Konflikte meidet.
Die Aum-Sekte sprach beide Aspekte des im Umbruch befindlichen, japanischen Charakters an, das Bedürfnis nach Folgsamkeit und den vehementen Widerspruch gegen eine wertefreie, zynische Moderne. Murakami hat auch eine Reihe von Sektenmitgliedern für sein Projekt gewinnen können. Er selbst vertritt die These, daß dem japanischen System die Auffangnetze für Aussteiger und Kritiker fehlen. Tatsächlich ist häufig eine zu große Aufgewecktheit Grund für den Eintritt meist junger Leute in Shoko Asaharas Orden gewesen. Der Sektenführer lockte durch Gesprächsbereitschaft, er hatte Antworten auf alle Fragen, die Eltern und Lehrer beiseite wischten. Auch der mystische Überbau der Sekte war eine Antwort auf das Schweigen einer weltlichen Gesellschaft, die mit seelischen Obdachlosigkeitsgefühlen nicht mehr umzugehen wußte.
Sobald der Aspirant Aum-Mitglied war, faßten ihn dann sehr diesseitige Mechanismen. Hohe Beitrittszahlungen erschwerten die Rückkehr in die Bürgerlichkeit, sklavische Arbeitspensen, monotone Riten und rüde Bestrafungsaktionen löschten den kritischen Geist aus, eine diktatorische Organisation führte zu Ichverlust und blindem Gehorsam. Murakami hat also in gewissem Grade recht, wenn er Aum zum Spiegel des heutigen Japan erklärt. Wer im Sektengefüge vorankommen wollte, brauchte dieselben Qualitäten, die ihm auch im Tokioer Alltag halfen, die Männer mußten gebildet, die Frauen attraktiv sein: "Bei Frauen kam es auf ihr Aussehen an. Wirklich! Nicht anders als in der normalen Gesellschaft." Eine Nonne, die sich den Avancen Shoko Asaharas widersetzte, wurde mit Elektroschocks behandelt und verlor dadurch zwei Jahre aus ihrem Gedächtnis. Andere Querköpfe hing man an den Füßen auf, bis sie den Tod herbeiwünschten; sie sollen nach dieser zweifelhaften Initiation die treuesten Mitglieder geworden sein.
"Untergrundkrieg" ist ein Indiz dafür, daß der Sarin-Anschlag in der japanischen Öffentlichkeit weiterwirkt. Die Katastrophe führte manchem seine Einsamkeit vor Augen. Wenn es darauf ankommt, läßt das System Gute wie Böse allein. Besonders bewegend ist der Einblick in die mit der Vergiftung verbundenen Grenzerfahrungen. Wer aus dem Koma zurückfand, ist oft auf lange Zeit nicht nur mit Kopfschmerzen und Gedächtnislücken, sondern auch mit Alpträumen, halluzinatorischen Tantalos-Qualen, mit Angst vor Kälte, Nacht und Gespenstern geschlagen.
Japans fehlende Worte
Für die Katastrophenopfer wenigstens hat das japanische Ideal persönlicher Unfehlbarkeit seine Plausibilität verloren. Sie haben auf grausame Weise erfahren, daß man des anderen bedarf und sich dafür nicht zu schämen hat. "Was wir brauchen, sind neue Worte", schreibt Murakami, "mit deren Hilfe wir eine neue Geschichte erzählen." Sein Buch beweist, daß es eine Fülle unbestechlicher, selbständig denkender Menschen unter den Leidträgern und Tätern gibt, die ihre eigene Geschichte so zu erzählen wissen, daß sie von geradezu alarmierendem allgemeinem Interesse ist. Dazu gehört nicht zuletzt ein vom japanischen Pferderennsport engagierter Jockey aus Irland. Abseits vom Aum-Anschlag spricht er auch über berufliche Erfolge - und kommt der Misere so vielleicht am nächsten: Die jungen, japanischen Reiter seien jetzt viel inspirierter als bei seiner Ankunft: "Dennoch bin ich der Meinung, daß sie sich noch mehr verbessern könnten, wenn sie kommunikativer mit den Pferden umgingen, aber das ist wahrscheinlich kulturell bedingt."
INGEBORG HARMS
Haruki Murakami: "Untergrundkrieg". Der Anschlag von Tokyo. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. Dumont Verlag, Köln 2002. 400 S., br., 18,-
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH