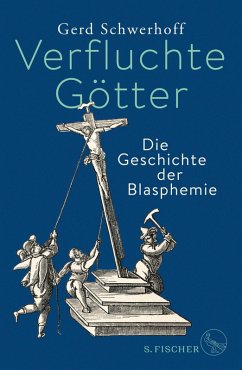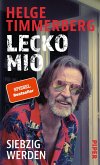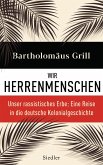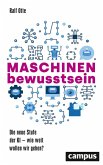Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Vorsicht bei allzu großer Nähe zu jenseitigen Mächten: Gerd Schwerhoff hat eine umfassende Kulturgeschichte der Blasphemie geschrieben.
Von Thomas Macho
Die zehn Gebote, die Moses am Berg Sinai offenbart wurden, waren überwiegend Verbote mit Strafandrohungen. Das zweite Verbot lautete bekanntlich: "Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht" (Ex 20,7). Im Dekalog wurde also ein frühes Verbot der Gotteslästerung, der Blasphemie, formuliert, wobei bis heute nicht ganz klar ist, welche Praktiken genau - Meineid, Fluch, Verhöhnung, Spott - inkriminiert waren. Blasphemie ist vielgestaltig, zumal offenbleibt, gegen wen sie sich eigentlich richtet: gegen Gott oder eine Glaubensgemeinschaft, gegen heilige Schriften, Bilder oder Rituale, gegen die Inhalte einer Religion oder gegen ihre Institutionen und Würdenträger.
In Deutschland wurde die Strafbarkeit der Blasphemie erst 1969, im Rahmen der Großen Strafrechtsreform, erheblich eingeschränkt. Seither schützt das Gesetz nicht mehr Gott, Religion oder Kirche, sondern nur mehr den "öffentlichen Frieden". In anderen Ländern, beispielsweise 2012 in den Niederlanden oder 2018 nach einem Referendum in Irland, wurden die einschlägigen Blasphemie-Paragraphen im Strafgesetz inzwischen ganz abgeschafft.
Gleich in der Einleitung seiner umfangreichen, gut lesbaren Geschichte der Blasphemie ruft Gerd Schwerhoff, Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Technischen Universität Dresden, in Erinnerung, wie aktuell das Thema immer noch ist: Er spannt einen Bogen vom Todesurteil, das Ajatollah Chomeini am 14. Februar 1989 gegen Salman Rushdie - Autor des Romans "Die satanischen Verse" - verhängt hat, bis zum mörderischen Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" am 7. Januar 2015.
Doch geht es nicht nur um den Islam. Am Rande erwähnt werden auch die Debatten um avantgardistische Kunst - von Oskar Panizza und George Grosz bis zur situationistischen Künstlergruppe "Spur" - oder die Auseinandersetzungen um Karikaturen, die zumeist weniger Gott als dessen irdische Vertreter angreifen, sei es der Prophet Mohammed oder der Papst. Mehrmals musste sich etwa die Satirezeitschrift "Titanic" gegen Klagen des Vatikans und der katholischen Kirche verteidigen. Was darf die Kunst, was darf Satire oder Kritik? Diese Fragen werden nach wie vor kontrovers diskutiert.
Gerd Schwerhoff hat keine Begriffs- oder Ideengeschichte verfasst, sondern eine farbig erzählte Kulturgeschichte, orientiert an den traditionellen Epochenbezeichnungen. Er beginnt mit den "antiken Fundamenten", mit dem zweimaligen Bericht von den beiden steinernen Tafeln im Buch Exodus, auf denen der Dekalog aufgezeichnet wurde, und mit der anschließenden Frage nach der Differenz zwischen Mono- und Polytheismus.
Die polytheistischen Religionen in der griechischen und römischen Antike kennen zwar auch die Blasphemie, oder besser die Asebie, die Gottlosigkeit, wie mehrere Fallgeschichten bezeugen - vom Asebie-Prozess gegen Sokrates bis zur Geschichte des Pausanias, wonach einige Knaben im Spiel eine Statue der Göttin Artemis "erdrosselten" und danach gesteinigt wurden; doch häufiger sind die Menschen im Polytheismus betroffen von den ständigen Rivalitäten und Streitigkeiten der Götter und Göttinnen auf dem Olymp. Man muss schon, wie Aias nach der Vergewaltigung der Kassandra, gleich mehrere Gottheiten, erst Athene, dann Poseidon, beleidigen, um den Zorn und die Rache der Unsterblichen herauszufordern.
Schwerhoff schildert den Aufstieg des Christentums, die Kodifizierung der Blasphemie als Kriminaldelikt in der lange dauernden Regierungszeit Justinians (im sechsten nachchristlichen Jahrhundert), die Ausgrenzung der Häretiker und den grassierenden Antijudaismus, der direkt mit der christlichen Gründungserzählung verknüpft wurde: Jesus sei als Gotteslästerer durch den Hohepriester Kaiphas angeklagt worden. Später wurden die Juden immer wieder als "gotteslästerliches Volk" beschimpft und verfolgt.
Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der Blasphemie im Islam, bevor Schwerhoff sich dem Mittelalter zuwendet, das er als "Zeitalter der Zungensünden" charakterisiert. Die Blasphemie sei im Mittelalter geradezu zu einer alltäglichen "sozialen Praxis" avanciert, wobei sich Schwerhoff mehrfach auf Johan Huizingas "Herbst des Mittelalters" bezieht, in dem Huizinga die Verbreitung der Blasphemie als "Ausdruck einer manchmal allzu großen Nähe und Vertrautheit mit den jenseitigen Mächten" interpretiert, beispielsweise in der einleitend zitierten Geschichte vom frommen maltesischen Fischer, der stets Gott verfluchte, wenn er zu wenige Fische fing.
Das folgende Kapitel über die Blasphemie in den Glaubenskämpfen der Frühen Neuzeit widmet sich den Bilderstürmen. Zunehmend wurde die Gotteslästerung nicht mehr bloß mit "Zungensünden", sondern mit Angriffen auf Heiligenbilder und Statuen assoziiert. Seit dem frühen siebzehnten Jahrhundert wurde die Blasphemie darüber hinaus - vor allem in der Literatur - mit Obszönität verknüpft, wie Schwerhoff an den Prozessen gegen Théophile de Viau, Claude Le Petit oder den Verleger und Buchhändler Edmund Curll demonstriert.
Die Verschränkung von Blasphemie und Pornographie schlägt eine Brücke in das Zeitalter der Aufklärung und in die Moderne, vom "göttlichen Marquis" bis zu Georges Bataille und zur bereits erwähnten künstlerischen Avantgarde. Zahlreiche Fallgeschichten dokumentieren die Konflikte um Repression und Skandalisierung, etwa nach der Hinrichtung des Chevaliers de La Barre, gegen die Voltaire - ebenso wie gegen die Hinrichtung von Jean Calas am 10. März 1762 - protestierte, indem er einen Brief als Flugblatt drucken ließ, in dem es hieß: "Ich weiß, mit welchem Eifer der Fanatismus sich erhebt gegen die Philosophie. Wie gerne würde er ihre beiden Töchter, die Wahrheit und die Toleranz, ebenso töten wie Calas."
Die letzten drei Kapitel kehren wieder zurück in die Gegenwart. Wie schon in der Einleitung schildert Schwerhoff die Aktualität eines "globalen Zeitalters der Blasphemie" an den Beispielen der Fatwa gegen Rushdie oder der Karikaturen des Propheten Mohammed. Kommentiert werden Blasphemie-Anklagen als Instrumente politischer Repression, etwa im Fall des Moskauer Punk-Gebets von Pussy Riot. Diese Debatten, so schließt Schwerhoff in einem Kapitel zum Streit um Blasphemie als "aufklärerische Tugend" oder "rassistische Hatespeech", bezeugen "die Mächtigkeit und die Dynamik eines öffentlichen Blasphemie-Diskurses, der jene Wirklichkeiten, die er widerzuspiegeln vorgibt, selbst produziert". Schwerhoff beklagt, dass "Schmähungen und Gegenschmähung, Empörung und das Gefühl der Verletzung, Anklage und Gegenaktionen" zur Verfestigung einer gefährlichen "Grenzziehung" zwischen einem diffusen Wir und Sie beitragen. Seine Geschichte der Blasphemie gewinnt am Ende das Profil einer Gegenwartsdiagnose, deren Gewicht als bedrückend wahrgenommen werden muss.
Gerd Schwerhoff: "Verfluchte Götter". Die Geschichte der Blasphemie.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2021. 528 S., geb., 29,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main