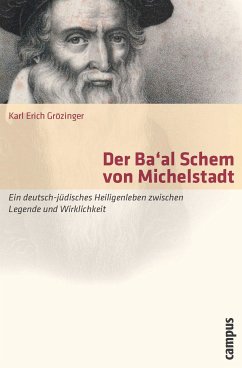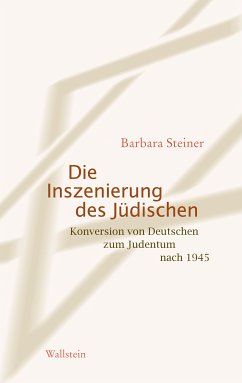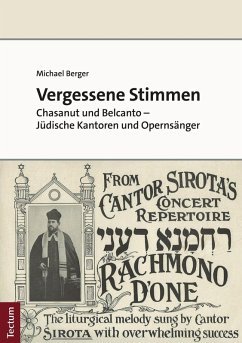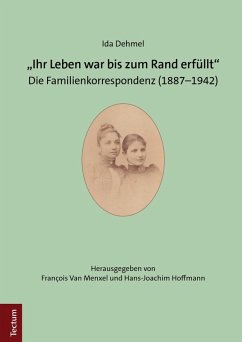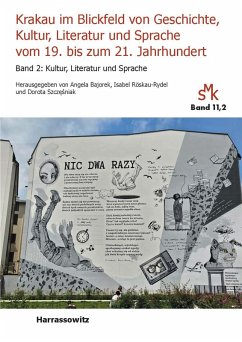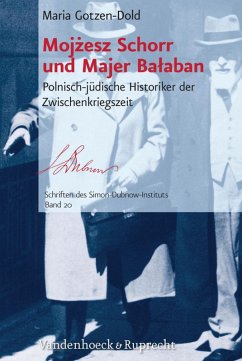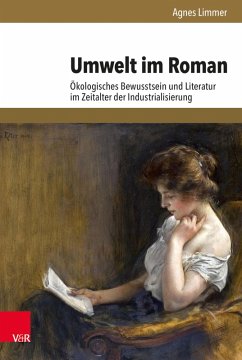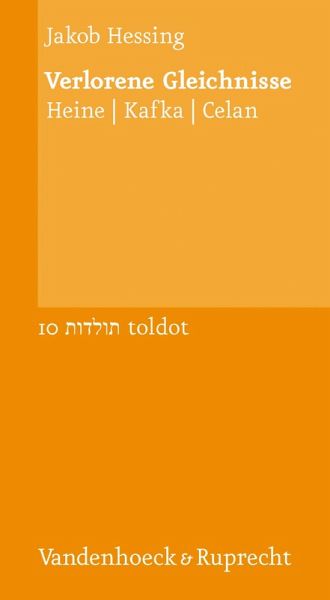
Verlorene Gleichnisse (eBook, PDF)
Heine, Kafka, Celan
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
23,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der israelische Germanist und Autor Jakob Hessing widmet sich in seinem Buch den Übergängen vom heiligen zum säkularen Text in der Moderne. Im Zentrum stehen Texte aus drei unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Entstehungszusammenhängen: die Werke Heinrich Heines, Franz Kafkas und Paul Celans. Der Autor deutet diese vor dem Hintergrund der Verwandlung religiöser Substanz in neue Freiheitsräume des Individuums, die seit Moses Mendelssohn den Eintritt der Juden in die deutsche Kultur begleitet hat. Dabei nimmt er vor allem das Gleichnis als eine sprachliche Konfiguration in den Blic...
Der israelische Germanist und Autor Jakob Hessing widmet sich in seinem Buch den Übergängen vom heiligen zum säkularen Text in der Moderne. Im Zentrum stehen Texte aus drei unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Entstehungszusammenhängen: die Werke Heinrich Heines, Franz Kafkas und Paul Celans. Der Autor deutet diese vor dem Hintergrund der Verwandlung religiöser Substanz in neue Freiheitsräume des Individuums, die seit Moses Mendelssohn den Eintritt der Juden in die deutsche Kultur begleitet hat. Dabei nimmt er vor allem das Gleichnis als eine sprachliche Konfiguration in den Blick, an der sich jener Wandlungsprozess am deutlichsten nachvollziehen lässt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.