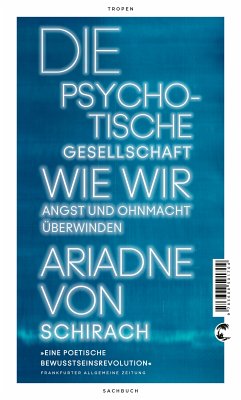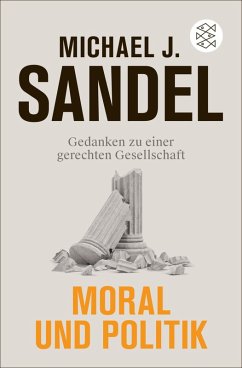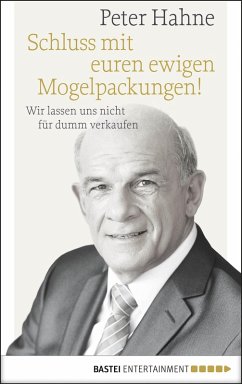Vertrauen - Die unsichtbare Macht (eBook, ePUB)
Die unsichtbare Macht
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 25,00 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Alle wollen es - Banken, Politik, Wissenschaft, das Internet und die Liebe: unser Vertrauen! Doch das Vertrauen steckt in der Krise, viele fühlen sich betrogen, von Medien, Parteien, Unternehmen. Der Philosoph Martin Hartmann analysiert in einer inspirierenden Gegenwartsdiagnose, was dran ist an der Krise. Und entdeckt ein grundlegendes Dilemma: Wir preisen das Vertrauen, wir vermissen es und beklagen seinen Verlust. Doch viele haben Angst vor der Verletzlichkeit, die mit Vertrauen einhergeht. Neue Formen der Überwachung werden hingenommen, an scheinbar bestätigten Meinungen festgehalten. D...
Alle wollen es - Banken, Politik, Wissenschaft, das Internet und die Liebe: unser Vertrauen! Doch das Vertrauen steckt in der Krise, viele fühlen sich betrogen, von Medien, Parteien, Unternehmen. Der Philosoph Martin Hartmann analysiert in einer inspirierenden Gegenwartsdiagnose, was dran ist an der Krise. Und entdeckt ein grundlegendes Dilemma: Wir preisen das Vertrauen, wir vermissen es und beklagen seinen Verlust. Doch viele haben Angst vor der Verletzlichkeit, die mit Vertrauen einhergeht. Neue Formen der Überwachung werden hingenommen, an scheinbar bestätigten Meinungen festgehalten. Das führt zu Konflikten, Unsicherheit und Stillstand. Grund genug für vertrauensbildende Maßnahmen! Eine erhellende Lektüre, die verstehen hilft, was Vertrauen eigentlich ist und für unser Leben bedeutet. Martin Hartmann ermutigt uns, wieder mehr Vertrauen zu wagen - für ein besseres Miteinander. Philosophie für alle!
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.