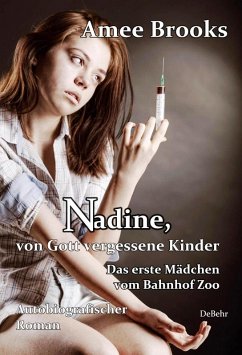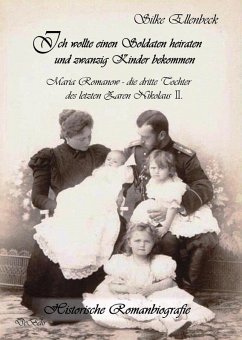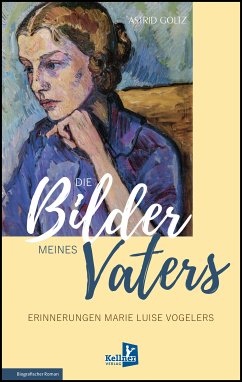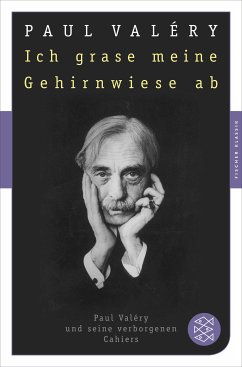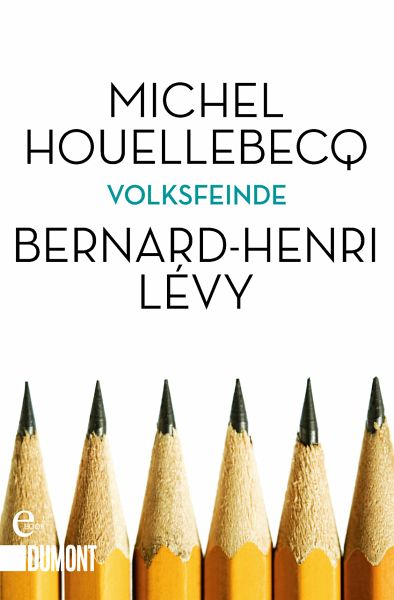
Volksfeinde (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 12,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nach den Kontroversen um den Roman ¿Unterwerfung¿ und den persönlichen Anfeindungen gegen seinen Autor ist dieses Duell in Worten aktueller denn je. Bernard-Henri Lévy und Michel Houellebecq sind zwei der wichtigsten Intellektuellen des französischen Literaturbetriebs und erwiesenermaßen 'Volksfeinde': Der umstrittene Philosoph trifft auf den meistgehassten französischen Schriftsteller der Gegenwart. Zwei bekennende Narzissten fragen sich, womit sie den Hass der Öffentlichkeit verdient haben, und sezieren das eigene Image mit kluger Koketterie: ein Schlagabtausch, der ins Private und P...
Nach den Kontroversen um den Roman ¿Unterwerfung¿ und den persönlichen Anfeindungen gegen seinen Autor ist dieses Duell in Worten aktueller denn je. Bernard-Henri Lévy und Michel Houellebecq sind zwei der wichtigsten Intellektuellen des französischen Literaturbetriebs und erwiesenermaßen 'Volksfeinde': Der umstrittene Philosoph trifft auf den meistgehassten französischen Schriftsteller der Gegenwart. Zwei bekennende Narzissten fragen sich, womit sie den Hass der Öffentlichkeit verdient haben, und sezieren das eigene Image mit kluger Koketterie: ein Schlagabtausch, der ins Private und Politische geht, poetologische Fragen ebenso behandelt wie philosophische und nebenbei glänzend unterhält.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, SLO, SK ausgeliefert werden.