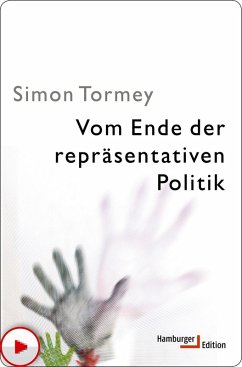Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Geht das Zeitalter der repräsentativ-demokratischen Politik wirklich zu Ende?
Man darf vermuten, dass es in ihrer Geschichte kaum je Zeiten gegeben hat, in denen nicht von einer Krise der Demokratie die Rede war. Das kann nicht anders sein, weil das Demokratie-Ideal für jede demokratische Wirklichkeit uneinholbar ist. Manchmal haben die allfälligen Krisendiagnosen etwas durchaus Artifizielles an sich und beschäftigen kaum jemanden außer den Intellektuellen. Manchmal aber sind Krisensymptome auch sehr handfest und für jedermann sichtbar. So verhält es sich gegenwärtig.
Es ist die repräsentative Verfasstheit der Demokratie, der viele Beobachter einen kritischen Zustand attestieren. Seit etwa zwei Jahrzehnten wird dieser Zustand von der Politikwissenschaft empirisch vermessen und theoretisch durchleuchtet. Was die Symptome angeht, herrscht weithin Einigkeit. Niemand kann sie leugnen: sinkende Wahlbeteiligung; ein dramatischer Rückgang der Mitgliederzahl der Parteien; ein noch dramatischerer Einbruch des Vertrauens in Politiker und Parteien; ein ganz neuartiges, vielfältiges spontanes Bürgerengagement in Bewegungen des Protestes, Bewegungen, die alle auf irgendeine Weise und zu irgendetwas nein sagen. Wie die Symptome zu deuten seien, darüber ist man sich weniger einig. An dieser Front lässt sich mit guten Gründen streiten.
Der australische, aber mit Europa durchaus vertraute Politikwissenschaftler Simon Tormey hat jetzt einen gut zweihundertseitigen Essay vorgelegt, der in seinem Titel ein entschiedenes Urteil ankündigt. Das Buch heißt "Vom Ende der repräsentativen Politik". Und seine Kernthese ist denn auch, dass das Zeitalter der repräsentativ-demokratischen Politik zu Ende gehe. Man dürfe hoffen, dass an die Stelle dieser Art von Politik etwas ganz Neuartiges treten werde, eine Demokratie, in der die Bürger, nicht mehr bereit, andere für sich handeln zu lassen, das politische Handeln selbst übernähmen. In der Vielgestaltigkeit des weltweiten Protestengagements zahlloser Menschen zeichne sich diese wahrhaft demokratische Zukunft bereits ab.
Tormey entfaltet seine These in enger Anlehnung an die reichlich vorhandene einschlägige Literatur, greift aber auch auf eigene Forschungsarbeit zurück. Er hat in den letzten Jahren verschiedenste Protestbewegungen in unterschiedlichen Teilen der Welt - die Zapatistas in Mexiko, die Occupy-Wall-Street-Bewegung in den Vereinigten Staaten, die Indignados in Spanien - genauer studiert und darüber auch schon publiziert. Nun zieht er in sechs Kapiteln die Summe, in einem locker gegliederten Argumentationsgang, der den Leser von der Beschreibung der bekannten Krisensymptome - den Parteien gilt dabei besondere Aufmerksamkeit - über die historische Verortung des Repräsentativsystems, unterschiedliche Versuche der Erklärung der Krise, einen als Fallstudie gedachten kurzen Bericht über die spanischen Verhältnisse zur Schlussfrage "Was soll aus alledem werden?" führt.
In diesem Argumentationsbogen versucht sich der Autor an einer schwierigen Balance. Er will einen entschieden engagierten Essay schreiben und will darüber doch nicht vergessen, dass er Wissenschaftler ist. Das gelingt leider nicht wirklich. Dass Tormeys starke Sympathien für die Protestbewegungen, für den "Wutbürger" jeder Couleur, ihn dahin führen, den Protest sehr pauschal zu idealisieren - er steht überall auf der Welt gegen "das Unrecht" auf -, mag noch hingehen. Die ebenso pauschale Verdammung der repräsentativen Demokratie als Elitenherrschaft, als Herrschaft der Reichen für die Reichen, als Herrschaft von einem Prozent über 99 Prozent ist ärgerlich, weil sie die komplexe Wirklichkeit weithin verfehlt. Diese Art von grober Vereinfachung, um es zurückhaltend zu formulieren, ist nicht das, was man von einem Politikwissenschaftler zu diesem Thema erwartet.
Es macht Tormeys Argumentation nicht überzeugender, dass ihm, wenn vom weltweiten Protest die Rede ist, begreiflicherweise nicht selten auch halbautoritäre und autoritäre Regime ins Visier geraten. Das lässt die Grenzen zwischen dem, was den etablierten Repräsentativdemokratien zuzurechnen, und dem, was ganz andersartigen politischen Systemen anzulasten ist, verschwimmen.
Die entscheidende Frage an Tormeys Essay ist mit solchen Einwänden freilich noch gar nicht gestellt. Bedeutet für ihn das Ende der repräsentativen Politik auch das Ende der repräsentativen Demokratie? Wenn nicht, wie ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen zu bestimmen? Wenn ja, was tritt an die Stelle der repräsentativen Demokratie? So ernst man die Frage, warum die repräsentative Demokratie einen Teil ihrer Bürger nicht mehr von sich überzeugt, nehmen muss: Das Handeln für andere ist das Wesen des Politischen.
Auch in der direktesten Demokratie handeln die Bürger, wenn sie politisch entscheiden, für andere. Die Frage ist nicht, ob sich das Handeln für andere durch ein Handeln eines jeden für sich selbst ersetzen lässt. Das wäre nicht das Ende der repräsentativen Politik, sondern das Ende der Politik. Die Frage ist, ob die, die für andere handeln, sich dessen bewusst sind; ob sie kontrolliert und zur Verantwortung gezogen werden können; ob alle Bürger eine Chance haben, wenn sie denn wollen, an dem Handeln für andere mitzuwirken. Wer in der Polemik gegen die repräsentativ verfasste Demokratie vergisst, dass auch die Demokratie Strukturen braucht, in denen Verantwortlichkeit für das Ganze institutionalisiert ist, schüttet in seinem Eifer, die Politik zur Sache aller zu machen, das Kind mit dem Bade aus. Tormey balanciert auf der Grenzlinie zwischen einem Demokratieverständnis, das diese Einsicht einschließt, und einem Demokratiewunschbild - keinem erfreulichen -, das sie ignoriert.
PETER GRAF KIELMANSEGG
Simon Tormey: Vom Ende der repräsentativen Politik. Hamburger Edition, Hamburg 2015. 231 S., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH