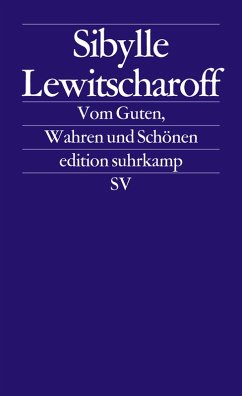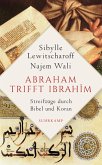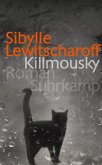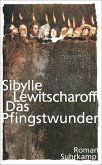Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Sibylle Lewitscharoff liest jetzt den Affen die Leviten
In seiner Dankesrede zum Zürcher Literaturpreis 1966 hatte Emil Staiger den Romanen und Bühnenstücken der Nachkriegsliteratur mangelnde Gesittung vorgeworfen. "Sie wimmeln von Psychopathen, von gemeingefährlichen Existenzen, von Scheußlichkeiten großen Stils und ausgeklügelten Perfidien. Sie spielen in lichtscheuen Räumen und beweisen in allem, was niederträchtig ist, blühende Einbildungskraft." Die Aufregung war immens, der vormals verehrte Literaturprofessor, der große Meister der immanenten Interpretation, wurde mit Schimpf und Schande überhäuft und zog sich verbittert zurück. Seitdem hat sich kein prominenter Akteur des Literaturbetriebs dergleichen getraut.
Sibylle Lewitscharoff hat sich in ihrem vergangenen Herbst erschienenen Roman "Blumenberg" nicht gescheut, dem berühmten Philosophen einen leibhaftigen Löwen auf den Teppich seines Arbeitszimmers zu legen, ebenso löwenherzig wettert sie nun in ihren Frankfurter und Zürcher Poetikvorlesungen gegen den zeitgenössischen Realismus und dessen Liebäugeln mit dem Vulgären. Bei aller Notwendigkeit genauer Beobachtung gehöre es zu seinen unangenehmen Schlagseiten, "im Dreck, im Verkommenen zu wühlen", möglichst unter der Vorspiegelung, dabei gewesen zu sein. Überhaupt gebe es "zu viele coole Texte über kaputte Typen. Die halbe Leipziger Romanschule übt sich darin, übrigens meist bar jeder eigenen Erfahrung in so extremen Milieus."
In der erzählenden Literatur sieht sie eine Überbewertung der Kreativität, hinter der meist nicht mehr stecke als ein Ringen um Anerkennung "mittels Provokation, Skandalen und Markierungsgesten"; mit eher schwächlichen Resultaten, namentlich der Preisgabe der Formen, "die das Mögliche erkunden". Auch das deutsche Theater sei der "Idiotie des Schockhaften" verfallen. Es zeige eine Gesellschaft "von schreienden Verrückten, die herumbatzen und herumschmieren wie Kleinkinder", eine Gesellschaft, die sich offenbar "als menschlichen Schrott betrachtet". Aber auch die Größen neigten auf ihre älteren Tage zur vulgären Regression, zu "hochnotpeinlichen alterssexelnden Suaden" Martin Walser, zu "ranschmeißerischem Unfug" Günter Grass in der "kindergartenhaften Eingemeindung" Fontanes, zur "Kalauermaschine" Elfriede Jelinek.
Gegen den "Eigenkreativwahn" der Heutigen und das "Affentheater des Zeitgeschmacks" beschwört Sibylle Lewitscharoff wie schon Staiger die leuchtenden Sterne der Tradition, Homer, Ovid, Vergil, Dante, Shakespeare, Goethe und ihren "Lieblingsautor" Kafka. Sie plädiert damit für die Inspiration aus der Tradition: "Gerade das etwas fremd Gewordene aus vergangenen Zeiten hat oft die Kraft, die eigenen Haltungen, das eigene Denken zu bereichern und in unverhoffte Richtungen zu lenken."
Wie Hans Blumenberg begreift die Autorin den Menschen als ein trostbedürftiges Mängelwesen, das nach "Erlösung von Schmutz und Schuld" dürstet, nach Entlastung vom Druck des Realitätsprinzips und nach Orientierung in einer unübersichtlichen Wirklichkeit. Im Gegensatz zu ihrem Verehrer Denis Scheck scheint Sibylle Lewitscharoff die klassizistische Formel der Einheit des Guten, Wahren und Schönen bei allem Augenzwinkern durchaus ernst zu nehmen. So verpflichtet sie die Literatur unumwunden auf die Vermittlung sittlicher Werte, vor allem auf die "Zähmung unserer mörderischen Energien", zugleich aber auf ästhetisches Vergnügen. Damit wird wie schon bei Emil Staiger unverkennbar das Horazsche prodesse et delectare gegen die zeitgenössische Literatur ausgespielt.
Dass diese Thesen einen neuen Literaturstreit auslösen, ist weder zu befürchten noch gar zu erhoffen. In Zeiten der massenmedialen Verbreitung des Vulgären ruft auch die traditionsbewusste Provokation nur mehr müdes Achselzucken hervor. Für Leser aber, die beim Namen gerufen werden wollen und die gleichermaßen gern mit den Toten und den Lebenden sprechen, für alle, die sich der herrischen Maßgabe des Realismus nicht beugen mögen, sind Sibylle Lewitscharoffs freche Lektüren eine große Freude. Denn sie ist kraft ihres Namens nicht nur eine ernste Levitenleserin, sondern im Schreiben auch ein "Witsch", ein listig unzuverlässiges Wesen, ja sogar gut schwäbisch ein dem Albernen gewogenes "Käsperle".
FRIEDMAR APEL
Sibylle Lewitscharoff: "Vom Guten, Wahren und Schönen". Frankfurter und Zürcher Poetikvorlesungen.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 200 S., br., 14,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main