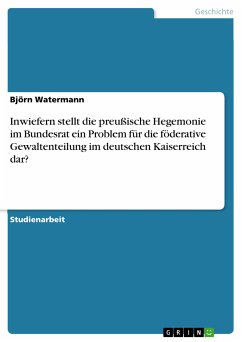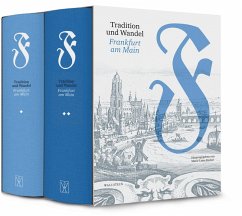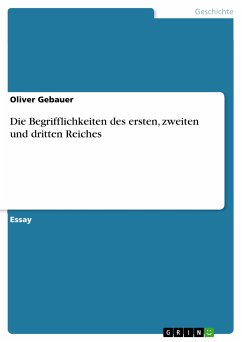Vom vielstaatlichen Reich zum föderativen Bundesstaat (eBook, PDF)
Eine andere deutsche Geschichte
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,90 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Buch mit Leinen-Einband)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In den meinungsprägenden Werken zur jüngeren deutschen Geschichte läuft die Entwicklung auf den Nationalstaat zu, mit dem sich die >verspätete Nation< doch noch in den europäischen Normalweg eingeordnet habe. Hier wird die Geschichte anders erzählt: das Alte Reich - kein Hindernis auf einem >Sonderweg< zum Nationalstaat und zur deutschen Staatsnation, sondern historische Wurzel des deutschen Föderalismus. Vom vielstaatlichen Reich zum föderativen Nationalstaat - diese Perspektive öffnet einen Blick, der die deutsche Geschichte nicht auf ein Ziel ausrichtet, das die Gegenwart vorgibt, ...
In den meinungsprägenden Werken zur jüngeren deutschen Geschichte läuft die Entwicklung auf den Nationalstaat zu, mit dem sich die >verspätete Nation< doch noch in den europäischen Normalweg eingeordnet habe. Hier wird die Geschichte anders erzählt: das Alte Reich - kein Hindernis auf einem >Sonderweg< zum Nationalstaat und zur deutschen Staatsnation, sondern historische Wurzel des deutschen Föderalismus. Vom vielstaatlichen Reich zum föderativen Nationalstaat - diese Perspektive öffnet einen Blick, der die deutsche Geschichte nicht auf ein Ziel ausrichtet, das die Gegenwart vorgibt, sondern ihre Offenheit und Umbrüche sichtbar macht.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.