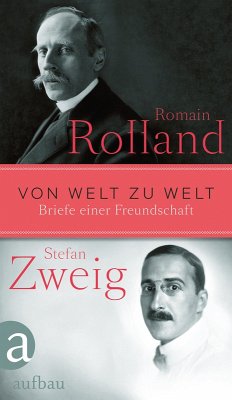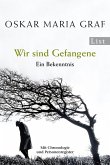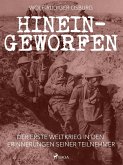Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Was verehrungsvoll begann, entwickelte sich im Ersten Weltkrieg zur weltanschaulichen Krise: Stefan Zweigs und Romain Rollands Briefwechsel.
Von Niklas Bender
Der Erste Weltkrieg brachte neue Geräusche hervor: Konkret galt das für den Schlachtenlärm, der die Soldaten bis zur Betäubung beschallte, im übertragenen Sinne für das politisch-mediale Dröhnen hinter der Front - für besonnene Geister muss es schwer erträglich gewesen sein. Diese Geräuschkulisse lässt gemäßigte Stimmen markant und überzeugend klingen - wie die von Romain Rolland (1866 bis 1944) und Stefan Zweig (1881 bis 1942). Ihren Briefwechsel zu Kriegszeiten legt der Aufbau Verlag vor: Er zeigt zwei Verteidiger der deutsch-französischen Sache, zwei Kulturvermittler, die sich an feindlichen Fronten wiederfinden. Der intellektuelle Kampf, den sie fechten, ist spannend wie ein Krimi.
Romain Rolland, der Literaturnobelpreisträger von 1915, ist selbst in Frankreich vergessen; sein ehedem so berühmter Bildungsroman "Jean-Christophe" schlummert in Frieden. Stefan Zweig erfreut sich dagegen eines Publikums, gerade in Frankreich: Er ist dort der meistgelesene Autor deutscher Sprache und hat es 2013 in die Pléiade-Reihe geschafft; auch in Deutschland hat er eine treue Leserschaft. Bei vielen Gebildeten freilich steht er unter Kitschverdacht.
Tatsächlich, der Briefwechsel, der (anders als im Untertitel suggeriert) schon 1910 einsetzt, beginnt mit großherzigen Leerformeln. Zu Zweigs Gunsten muss man sagen: Der erst 28 Jahre alte, noch wenig bekannte Autor muss sich vorsichtig an den Älteren herantasten, der international bereits einen Namen hat. Der "Meister" (Rolland wird sich diese Anrede erst Jahre später verbitten) will umworben sein, und Zweig dient sich als Verbreiter seines Werks im deutschsprachigen Raum an. Selbst wenn man die Diplomatie in Rechnung stellt, ist offensichtlich, dass die tönernen Phrasen Denken und Stil der beiden verkörpern: Da spricht Rolland vom "harmonischen Zusammenhang der Menschheitsseele" und fährt das Pathos der laizistischen Linken auf. Zweig benutzt empfindsame Gemeinplätze und hält fest, dass es "keine schöpferische Kraft als Liebe und Achtung" gebe. Dazu könnten Sade, Baudelaire, Flaubert Erhellendes sagen, aber die Korrespondenten verehren Tolstoi, Whitman, Renan, Jaurès. Kurz: Man ist sich über "jene Freudigkeit des Weltrausches" (Zweig) einig. Da gähnt der Hund hinterm Ofen und bettet den Kopf auf die Pfote.
Munter wird er, als der Krieg ausbricht. Zweig engagiert sich an der Heimatfront in Wien; Rolland setzt sich beim Roten Kreuz in Genf ein. Die beiden führen ihre Korrespondenz fort, mit einem Mal jedoch stehen Einigkeit und hehre Ideale auf dem Spiel: Der Austausch zwischen europäischen Geistern und Menschheitspropheten wird unbequem. Es entsteht ein Informationsgefälle: Zweig mag Berichten von Greueln in Belgien oder Zerstörungen in Ostfrankreich nicht glauben ("Reims war eine Verleumdung"), während Rolland sie den Deutschen ankreidet. In der neutralen Schweiz, nahe am Herzen der internationalen Hilfsorganisation, ist er sicher besser informiert als Zweig, der in den ersten Monaten der Propaganda Glauben schenkt: "Ich verstehe die Bitterkeit eines Volkes, dem in der Weltgeschichte einige Siege wie jener von Tannenberg, wo eine Viertelmillion Russen bis auf den letzten Mann vernichtet wurden, einfach weggeleugnet werden und der Hass ihm den Ruhm nehmen will" (3. November 1914). Der Wiener fühlt sich "als Deutscher", meint, "jenes Schicksal des Weltmisstrauens, das ich vom Judentum her kenne", in der Propaganda gegen die Deutschen wiederzufinden. Ende 1915 besinnt er sich auf österreichische "Liberalität" und tut gut daran.
Die Humanisten greifen nun zu harten Bandagen. Rolland ermahnt Zweig, im Namen der deutschsprachigen Intellektuellen gegen Krieg und Obrigkeit zu protestieren: "Ich verstehe die persönlichen Gründe Ihres Schweigens vollkommen, mein lieber Freund. Aber ich beklage Ihr universelles Schweigen." Das ist gemäßigter als der offene Brief an Gerhart Hauptmann aus dem August 1914 (später Teil von Rollands Essaysammlung "Über dem Getümmel", 1915), in dem Rolland Hauptmann aufgefordert hatte, "die Stimme gegen die Hunnen, die Sie kommandieren, zu erheben". Es ist dennoch von wünschenswerter Deutlichkeit.
Die Rolle des kritischen Intellektuellen liegt Zweig weniger: Er ist Gesinnungsethiker und sein Verständnis von medialer Öffentlichkeit mitunter vordemokratisch - der Unterschied zwischen dem demokratischen West- und dem obrigkeitsstaatlichen Mitteleuropa wird greifbar. Am 19. Januar 1915 schreibt er, "die Regierungen haben bei uns den Zeitungen jede Discussion über Friedensformen, Entschädigungen etc. verboten, was sehr klug ist, weil die Lächerlichkeiten der französischen Presse, die Deutschland im Voraus ,aufteilten' und jetzt noch sich gegenseitig seine zerfetzten Glieder zuweisen, bei uns vermieden sind". Lächerlichkeiten sind der Preis für Pressefreiheit: Der Dünkel eines Bürgertums, das aus Angst vor Sittenverfall willig die Kandare in den Mund nimmt, erschreckt. Schließlich überzeugt manch nationales Vorurteil Zweigs, etwa gegen England, kaum.
In großen Fragen zeigt Rolland sich realistischer, auch kalkulierender: Seine Liebe zur Menschheit ist ein Erbarmen, "das sich aus viel Mitleid und viel Ironie zusammensetzt". Zweig ist eher naiv, hofft auf ein rasches Kriegsende und eine Annäherung der Völker; die Soldaten hätten sich im Felde schätzen gelernt. In Geschäftsdingen allerdings zeigt er sich gewitzt: Er ermuntert Rolland, Prozente auf seine übersetzten Werke zu nehmen, um nicht den Verlegern allen Profit zu lassen.
Der Krieg dauert, die Gemüter beruhigen sich: Sogar der Stil der Korrespondenten nähert sich an, wie Peter Handke in seinem Begleitwort festhält. Rolland und Zweig gelingt es, sich in zentralen Punkten zu einigen: der Wille zu Frieden und Völkerverständigung, das Misstrauen gegenüber den Eliten, das Vertrauen auf das Volk, die Pflege des Humanen. Einig sind sie sich auch über die "ungeheure Macht der Zeitungen", über die Zweig Ende 1915 schreibt: "Nie hat die Welt so sehr unter dem Zwang des Wortes gelebt, und das Erstaunlichste war, dass eine Zeitlang bei allen Völkern die Worte mehr Wirklichkeit hatten als die Taten, die Wirklichkeit selbst." Gleichwohl bedienen sie sich ihrer jeweils auf geschickte Weise.
Beide Autoren sind in ihren Ländern isoliert. Sie helfen einander und ihren Bekannten, so Rilke, dessen Pariser Wohnung zwangsgeräumt wurde. Sie treffen sich auf neutralem Grund, in der Schweiz: Von 1917 an weilt Zweig mit seiner Lebensgefährtin Friderike von Winternitz dort; es gelingt ihm, sich vom Dienst suspendieren zu lassen. Er beginnt eine Biographie Rollands, sein "Bekenntnis zu einem Menschen, der mir und manchem das stärkste moralische Erlebnis unserer Weltwende war". Da ist er wieder, der schäumende Enthusiasmus.
Interessant ist der sorgfältig übersetzte und edierte Briefwechsel, weil er das Gegenstück bietet: Es beeindruckt, wie hier zwei Intellektuelle um die Möglichkeit eines Friedens ringen, mit sich, mit dem anderen. Und es erlaubt, beide neu zu entdecken. In ihrer Freundschaft waren sie Zukunftsträger, über ihr Werk hinaus.
Romain Rolland, Stefan Zweig: "Von Welt zu Welt". Briefe einer Freundschaft 1914-1918.
Mit einem Begleitwort von Peter Handke. Aus dem Französischen von Eva und Gerhard Schewe (Briefe Rollands) und Christel Gersch (Briefe Zweigs). Aufbau Verlag, Berlin 2014. 462 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main