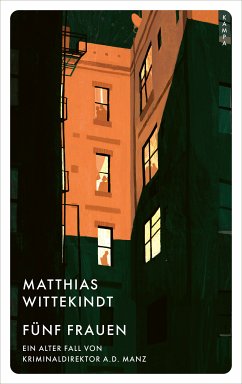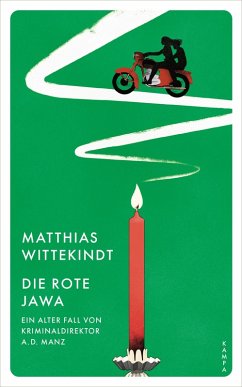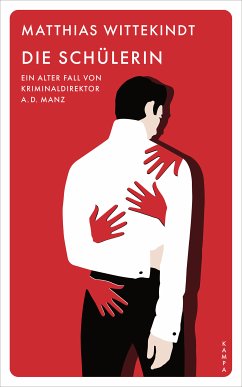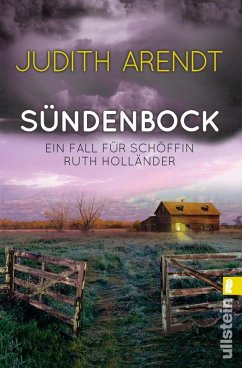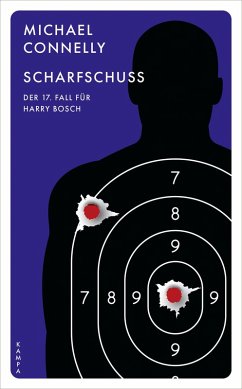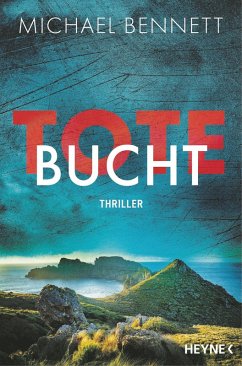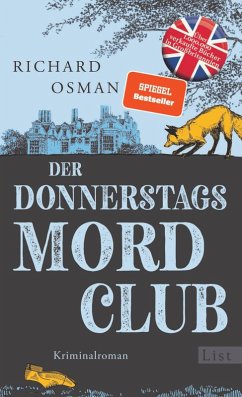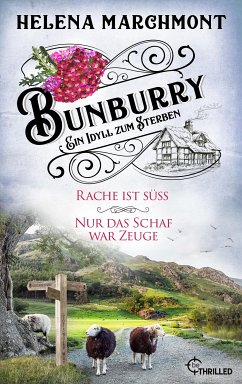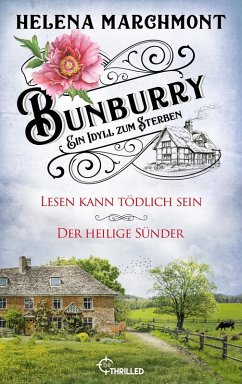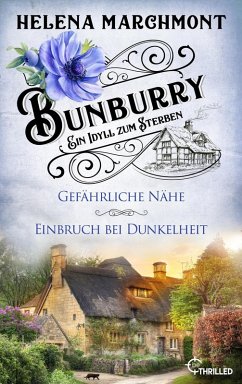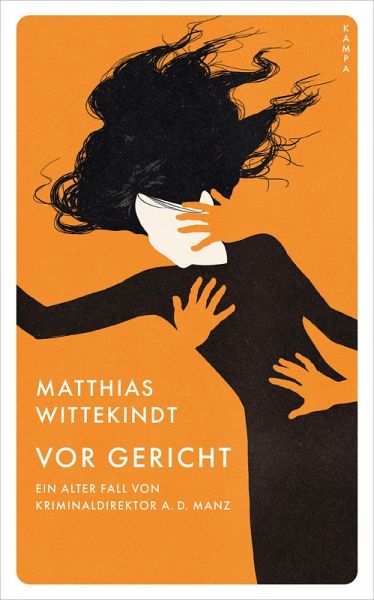
Vor Gericht / Kriminaldirektor a.D. Manz Bd.2 (eBook, ePUB)
Ein alter Fall von Kriminaldirektor a. D. Manz
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,90 €**
14,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Kriminaldirektor a. D. Manz hat sich behaglich eingerichtet in seinem Ruhestand im Dresdner Umland. Er rudert auf der Elbe, kümmert sich um seine Enkelkinder. Doch dann reißt ihn ein Brief der Staatsanwaltschaft Berlin aus seinem Alltag: Manz soll vor Gericht aussagen. Es geht um einen Mord im Jahr 1990, seinen letzten Fall in Berlin, den er nicht mehr abschließen konnte, weil er versetzt wurde. Jetzt, über zwanzig Jahre später, scheint der Mörder gefunden. Und es geschieht, was Manz nie wollte: Er versinkt in der Vergangenheit, in alten Denkmustern, und auch Vera erscheint vor seinem in...
Kriminaldirektor a. D. Manz hat sich behaglich eingerichtet in seinem Ruhestand im Dresdner Umland. Er rudert auf der Elbe, kümmert sich um seine Enkelkinder. Doch dann reißt ihn ein Brief der Staatsanwaltschaft Berlin aus seinem Alltag: Manz soll vor Gericht aussagen. Es geht um einen Mord im Jahr 1990, seinen letzten Fall in Berlin, den er nicht mehr abschließen konnte, weil er versetzt wurde. Jetzt, über zwanzig Jahre später, scheint der Mörder gefunden. Und es geschieht, was Manz nie wollte: Er versinkt in der Vergangenheit, in alten Denkmustern, und auch Vera erscheint vor seinem inneren Auge, die Kollegin, mit der er damals zusammengearbeitet hat und die sich kurz darauf das Leben genommen hat. Haben sie bei ihren Ermittlungen einen Fehler gemacht? Beim Prozess in Berlin muss Manz feststellen, dass etwas gründlich schiefläuft. Steht ein Unschuldiger vor Gericht? Die Aufklärung des Falls verschränkt sich untrennbar mit Manz' Blick in seine eigene Vergangenheit, der Auseinandersetzung mit sich selbst, seinem älterwerden - und all das vor dem Hintergrund der wiedervereinigten Bundesrepublik.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote