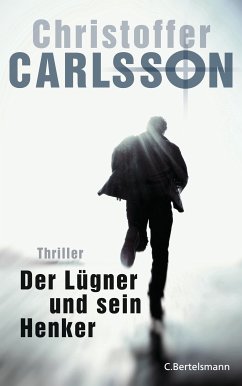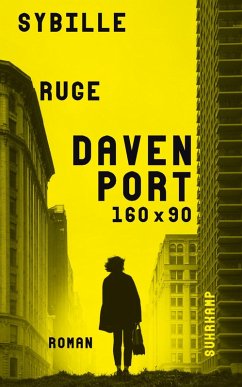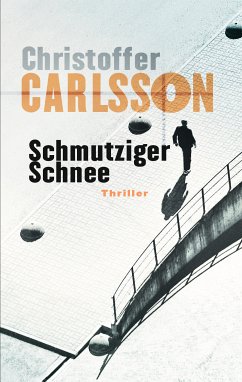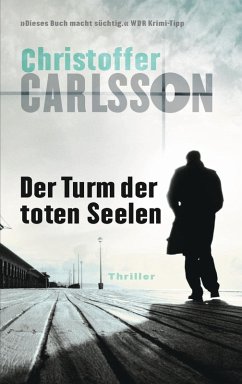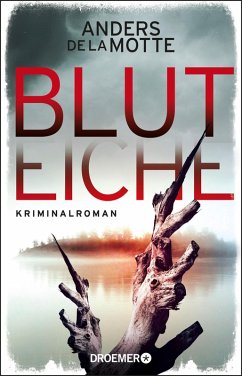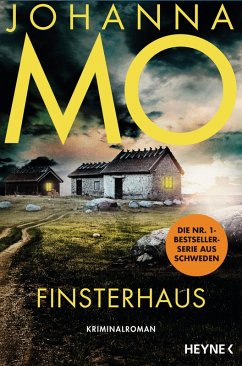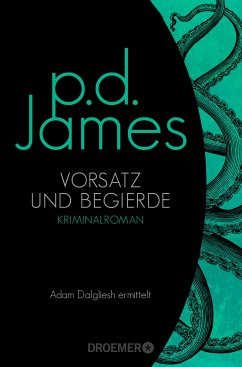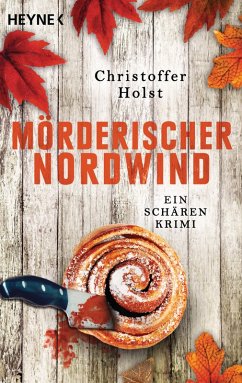Was ans Licht kommt / Die Halland-Krimis Bd.2 (eBook, ePUB)
Kriminalroman Platz 1 der Krimibestenliste
Übersetzer: Ackermann, Ulla
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 23,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was ans Licht kommt von Christoffer Carlsson ist ein fesselnder schwedischer Kriminalroman, der wahre Ereignisse mit fiktiven Elementen verbindet. Ein spannender Thriller über Schuld, Obsession und die Suche nach der Wahrheit, der tief in die Abgründe der menschlichen Psyche blickt. Am Abend des 28. Februar 1986, als in Stockholm Olof Palme ermordet wird, geht bei der Polizei im südschwedischen Halmstad der anonyme Anruf eines Mannes ein. Er habe eine Frau vergewaltigt. Und er werde es wieder tun. Das Opfer stirbt. Und der Täter lässt seinen Worten Taten folgen: Zwei weitere Frauen werden...
Was ans Licht kommt von Christoffer Carlsson ist ein fesselnder schwedischer Kriminalroman, der wahre Ereignisse mit fiktiven Elementen verbindet. Ein spannender Thriller über Schuld, Obsession und die Suche nach der Wahrheit, der tief in die Abgründe der menschlichen Psyche blickt. Am Abend des 28. Februar 1986, als in Stockholm Olof Palme ermordet wird, geht bei der Polizei im südschwedischen Halmstad der anonyme Anruf eines Mannes ein. Er habe eine Frau vergewaltigt. Und er werde es wieder tun. Das Opfer stirbt. Und der Täter lässt seinen Worten Taten folgen: Zwei weitere Frauen werden ermordet aufgefunden. Polizist Sven Jörgensson wird mit dem Fall betraut. Für ihn und seinen Sohn Vidar beginnt eine schwere Zeit. Während der Teenager versucht, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, wird Sven von der Besessenheit getrieben, den Mörder zu finden. Bis zu seinem Tod. Erfolglos. Jahrzehnte später glaubt Vidar, den Fall endlich gelöst zu haben. Doch als ein Schriftsteller beginnt, sich für die Morde zu interessieren, wird klar, dass die Wahrheit komplexer ist als gedacht. Seine Nachforschungen enthüllen neue Facetten des Falls und bringen schockierende Erkenntnisse über ein Verbrechen ans Licht, das keine einfachen Antworten zulässt. Was ans Licht kommt von Christoffer Carlsson ist ein fesselnder schwedischer Kriminalroman, der wahre Ereignisse mit fiktiven Elementen verbindet. Ein spannender Thriller über Schuld, Obsession und die Suche nach der Wahrheit, der tief in die Abgründe der menschlichen Psyche blickt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote