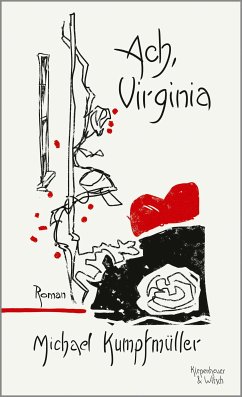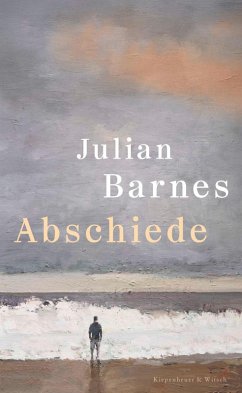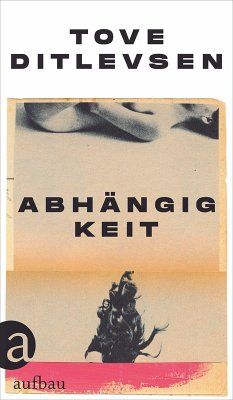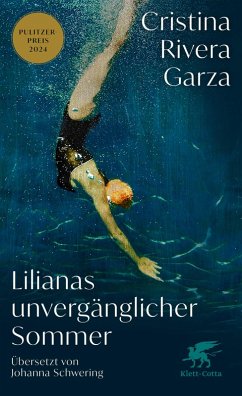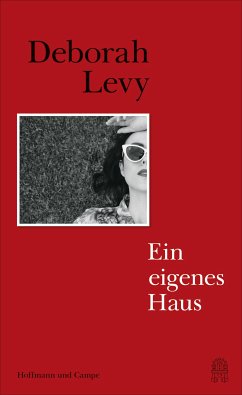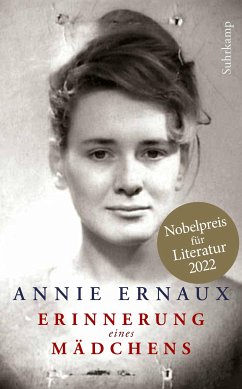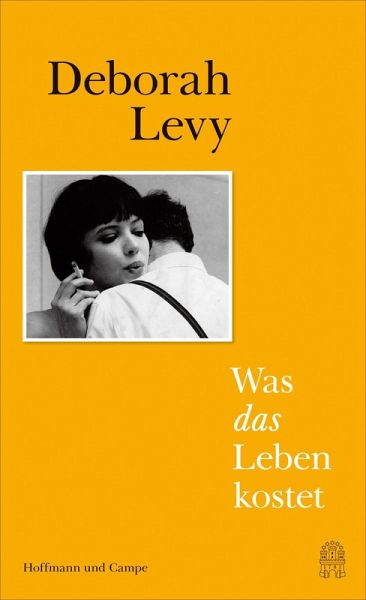
Was das Leben kostet (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ausgezeichnet mit dem Prix Femina étranger 2020 Wenn sich das Leben ändert, tut es dies meist radikal. Deborah Levy und ihr Mann gehen getrennte Wege, ihre Mutter wird bald sterben. Doch die entstehende Lücke bedeutet auch Raum für Neues. In präziser und suggestiver Prosa erschreibt Levy sich aus den Bruchstücken ihres alten Selbst ein neues und fragt: Was heißt es, frei zu sein - als Künstlerin, als Frau, als Mutter oder Tochter? Und was ist der Preis dieser Freiheit? »Jeder Satz ein kleines Meisterwerk«, schreibt The Telegraph, und so wird aus einer individuellen Geschichte ein leb...
Ausgezeichnet mit dem Prix Femina étranger 2020 Wenn sich das Leben ändert, tut es dies meist radikal. Deborah Levy und ihr Mann gehen getrennte Wege, ihre Mutter wird bald sterben. Doch die entstehende Lücke bedeutet auch Raum für Neues. In präziser und suggestiver Prosa erschreibt Levy sich aus den Bruchstücken ihres alten Selbst ein neues und fragt: Was heißt es, frei zu sein - als Künstlerin, als Frau, als Mutter oder Tochter? Und was ist der Preis dieser Freiheit? »Jeder Satz ein kleines Meisterwerk«, schreibt The Telegraph, und so wird aus einer individuellen Geschichte ein lebenskluges und fesselndes Zeugnis einer zutiefst menschlichen Erfahrung. »Das Leben bricht auseinander. Wir versuchen es in die Hand zu nehmen, versuchen es zusammenzuhalten. Bis uns irgendwann klar wird, dass wir es gar nicht zusammenhalten wollen.«
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.