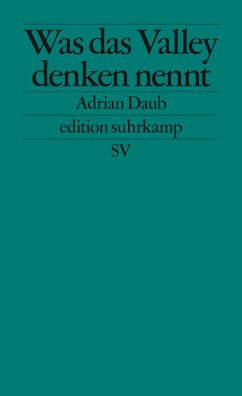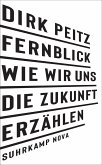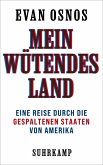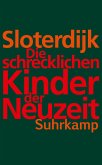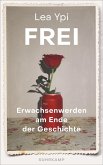Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Über die Rhetorik des Silicon Valley
"Dieses Buch", so beginnt Adrian Daub seinen Text, "handelt von der Ideengeschichte an einem Ort, der gerne so tut, als hätten seine Ideen keine Geschichte." Diese Geschichte zeichnet er anhand von sieben Zentralbegriffen der "Ideologie der Techbranche" nach: Aussteigen, Inhalt, Genie, Kommunikation, Begehren, Disruption und Scheitern. Daub zeigt überzeugend, dass der Mainstream des Denkens der Technologiebranche keineswegs geschichtslos ist, sondern eine Historie und einen Kontext hat, den es zu betrachten lohnt. Denn so flach die dortige Rezeption von Figuren wie René Girard, Marshall McLuhan, Ayn Rand und Joseph Schumpeter auch ist: Diese Art des Denkens, die von Kalifornien aus buchstäblich die ganze Welt berührt, ist überaus wirkmächtig - und zwar nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell. Begriffe des Techsektors vereinnahmen "unsere kollektive Phantasie".
Daub zeigt anschaulich, wie aufgeblasen und am Ende konventionell die Slogans sind, die in den Wirtschaftsmedien ebenso Verwendung finden wie in Büchern über und von Technologiehelden wie Steve Jobs und Peter Thiel. Die von Daub diagnostizierte "Verachtung für den Inhalt" macht es offenbar leicht, "revolutionär zu sein, ohne irgendwas zu revolutionieren". Das mag eine Unterschätzung der Digitalisierungsindustrie sein, trifft aber mit Blick auf ihre Rhetorik den Nagel auf den Kopf.
So wird deutlich, dass das dauernde Lob des Scheiterns auf einer krassen Fehlinterpretation Samuel Becketts beruht und letztlich auf der Annahme fußt, jedes Scheitern sei nur eine Vorstufe zum strahlenden Erfolg. Genau betrachtet, hat man es hier mit einem reichlich individualistischen "Selbsthilfeethos" und einem "Errettungsnarrativ" zu tun, das seine religiösen Wurzeln kaum verleugnen kann.
Der enorme ökonomische Erfolg des Valleys wird zwar bisweilen etwas höhnisch kommentiert, bleibt aber letztlich unverstanden. Dass der Autor nicht in Wirtschaftstheorie dilettiert, tut dem Buch freilich gut. Auch verzichtet der Literaturwissenschaftler Daub - im Gegensatz zu manch anderen Geisteswissenschaftlern, die über wirtschaftliche Themen schreiben - auf steile antikapitalistische Thesen. Mit dieser Perspektive gelingt ihm ein überaus lesenswertes Buch, das sehr schön zeigt, wie produktiv eine geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit ökonomischen Themen sein kann.
FRED LUKS
Adrian Daub: Was das Valley denken nennt. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 159 Seiten, 16 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main