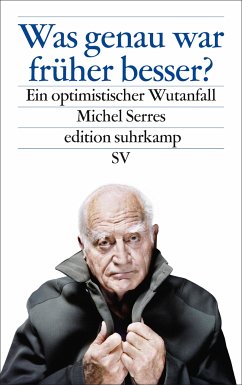Michel Serres wuchs vor über achtzig Jahren im ländlichen Südwestfrankreich auf, und er kann uns erzählen, wie es wirklich war: Ja, die Hühner mögen alle frei herumgelaufen sein, und die Schweine wurden noch nicht mit Antibiotika behandelt. Aber Seuchen und Krankheiten waren an der Tagesordnung, bei Tieren wie bei Menschen. Zwar gab es keine Internetpornos, doch manch junges Paar glaubte, die Liebe werde durch den Bauchnabel gemacht. Die Nostalgie für das Vergangene, so ermahnt uns Serres, lässt uns vergessen, was unsere Gegenwart so wertvoll macht.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Michel Serres bekommt einen unwiderstehlichen Wutanfall gegen die Verklärung der Vergangenheit
Die These, dass früher alles besser war, war noch nie so beliebt wie heute. Ob es um Politik oder den Journalismus geht, ums Wetter, um die Kunst oder die Liebe: Überall kann man sich darauf verlassen, dass jemand auf die Probleme der Gegenwart mit der Verklärung der Vergangenheit antwortet. Sogar das gute alte Internet, so hörte man zuletzt immer wieder, könnte bald nicht mehr sein, was es einmal war. So laut ist dieser Defätismus, so hartnäckig und allgegenwärtig, dass man über jeden Widerspruch dankbar sein muss. Und gleichzeitig ist er so falsch, so lächerlich, so leicht zu widerlegen, dass sich seine Zurückweisung nahezu von selbst versteht; im schlimmsten Fall ist auch die Behauptung des Gegenteils nur eine Phrase.
Wenn sich nun also der 88-jährige französische Philosoph Michel Serres die Frage stellt "Was genau war früher besser?", dann kann man sicher seine Zweifel haben, ob es dafür wirklich einen feinsinnigen Denker wie ihn braucht, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass die Antwort, um es angemessen kurz zusammenzufassen, lautet: "Nicht viel!". Doch wenn man sich jemanden für den Job aussuchen könnte, all den grantelnden Kulturpessimisten die Ohren langzuziehen, kommt Serres einer Idealbesetzung ziemlich nahe: Als Mitglied der Académie française ist er, einerseits, schon von Amts wegen der Pflege der französischen Sprache verpflichtet. Was ihn, andererseits, nicht davon abhält, die Fortschritte der modernen Kommunikation zu preisen. Wie ernst es ihm mit seiner Gegenwärtigkeit ist, bewies er schon 2013, als er den "kleinen Däumlingen" der Generation Smartphone zurief "Erfindet euch neu!", und zwar in einer 77-seitigen Liebeserklärung, die sich auch mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Millennials bequem bewältigen ließ. Nun legt er in der gleichen Länge einen Text nach, den er als "optimistischen Wutanfall" bezeichnet.
Auch diesmal tritt Serres wieder mit dem enormen Charme unverwüstlicher Gelassenheit auf, der sich auch seiner einnehmenden Rolle verdankt: Als Verbündeter der Jugend gegen seine eigene Generation spielt er den Kronzeugen, der seinen Optimismus nicht nur aufgekratztem Idealismus verdankt, sondern der eigenen reichen und langen Lebenserfahrung. Den "Meckergreisen" und "redseligen Cholerikern", die so gerne davon reden, dass früher alles besser war, hält er deshalb entgegen: "Das trifft sich gut, denn bei diesem Früher, da war ich schließlich dabei. Ich kann ein Expertenurteil abgeben."
So also erinnert Serres seine schlechtgelaunten Altersgenossen an all die vergangenen Zumutungen und Schrecken, die sie in ihrer Nostalgie so oft vergessen: an die harte körperliche Arbeit im Haushalt, auf dem Feld, in der Fabrik; an verschmutzte Flüsse und ungewaschene Bettlaken; an politische Ideologien und sexuelle Tabus; und immer wieder an den Krieg, der von Geburt an seinen Körper formte, sein Herz und sein Hirn. Und weist die nörgelnden Greise darauf hin, dass schon die Tatsache, dass sie heute so viele sind, ihre These widerlegt: "Früher" wären sie, dank Pocken, Krieg und Syphilis nicht nur in der Minderheit, sondern in der Regel schon tot, bevor sie überhaupt in das Alter kommen, in dem sie heute in Rente gehen.
Es sind vor allem die Lebendigkeit, das Geistesgegenwärtige, der Witz, denen Serres' Zwischenruf seine Kraft verdankt, weil er damit den Horror des vermeintlichen Paradieses so anschaulich macht, dass einem sämtliche Kritik an aktuellen Missständen erst einmal im Hals stecken bleibt: Was sind schon Fake News gegen die Manipulationen der faschistischen Staatspropaganda? Wer wollte die Einsamkeit der vernetzten Menschen gegen die aufgezwungenen Zugehörigkeiten nationaler oder religiöser Gemeinschaften eintauschen? Welcher Kritiker des Nanny State sehnt sich nach der Freiheit zurück, überall auf die Straße zu kacken, wie es noch in den fünfziger Jahren auch in Europa gang und gäbe war? Wer eine Zeit wiederhaben will, welche, so jedenfalls die Illusion, noch von Langsamkeit, Übersichtlichkeit, Natürlichkeit geprägt war, dem präsentiert Serres den Preis in aller Drastik: die Zahnoperationen ohne Betäubung, die chronischen Rückenschmerzen ganzer Generationen von Bauern, die Aufmärsche "zu Ehren von Marionetten", das Aufstehen um vier, den offenen Antisemitismus, die Disziplinierungen im Internat, die kalten Betten. Überall im Idyll lauern die Maden, wie damals regelmäßig im Fleisch der Schweine, gegen die auch nicht half, dass man noch wusste, wo es gemästet wurde.
Manchmal, wenn es um das Lob der modernen Technologien geht, liest sich seine Polemik, als hätte Serres in den 35 Jahren, die er nun in Stanford lehrt, ein bisschen zu viel vom ungebrochenen Fortschrittsglauben des Silicon Valley inhaliert: Vom "Wunder des Handys" ist da die Rede, welches eine "wahre Liebeskorrespondenz" erst ermöglicht habe, weil es die zarten "Seufzer und Geständnisse" der Liebenden in der notwendigen Geschwindigkeit übermittelt; von der "Sensation" eines neuartigen "Kommunikationsraums", in dem die Menschen "ihren bloßen Empfängerstatus überwunden" haben. Und doch würde man, vor die Wahl gestellt, genau wie Serres jederzeit "die Lügen, die Lager, die Verbrechen und das Gift von früher" gegen "die sanfte Realität eines Videospiels" eintauschen.
Wenn man trotzdem ein wenig nostalgisch wird angesichts Serres' überzeugender Bilanz, dann liegt das daran, dass auch sein unwiderstehlicher Optimismus heute fast schon von gestern ist: Er spiegelt eine Sehnsucht nach einer Zukunft wieder, für die sich gegenwärtig weder die politische Ideologie der Alternativlosigkeit noch der Optimierungswahn der Technik interessieren. Statt der Utopie einer Demokratie, von der Serres glaubt, dass sie erst noch geboren wird, bringt der Fortschritt zurzeit vor allem Projektionen der Vergangenheit hervor, berechnet mit phantastisch leistungsstarken Computern, die immer genauer vorhersagen können, was passieren wird, wenn die Menschen nur genauso leben, denken, handeln, wie sie es immer getan haben. Weshalb niemand mehr Grund hat, sich nach vergangenen Zeiten zu sehnen, als jene, die sich mehr Erneuerung, Vorwärtsgewandtheit, Wandel wünschen. Was nämlich früher wirklich besser war: Es gab noch Zukunft. Und vielleicht deshalb viel weniger Menschen, die fanden, dass früher alles besser war.
HARALD STAUN
Michel Serres: "Was genau war früher besser? Ein optimistischer Wutanfall". Aus dem Französischen von Stefan Lorenzer. Suhrkamp, 80 Seiten, 12 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH