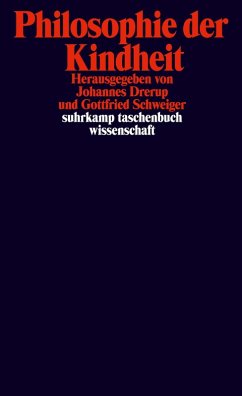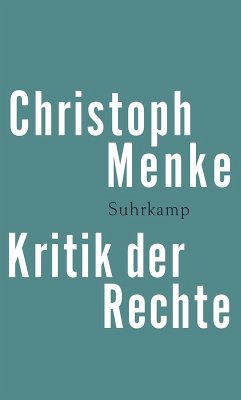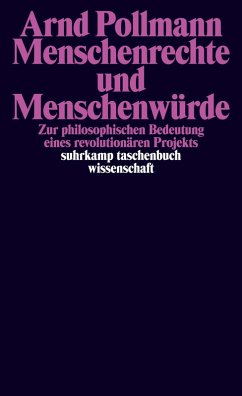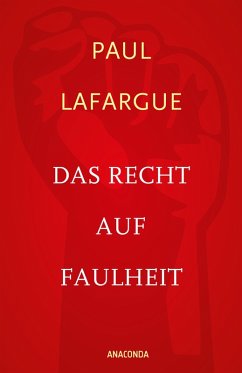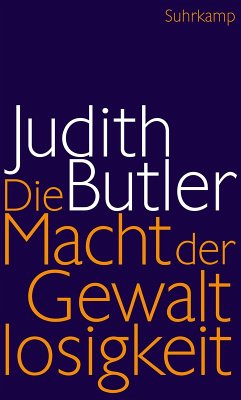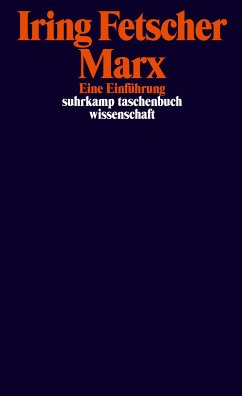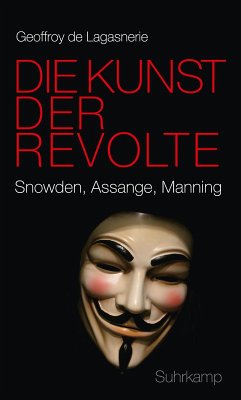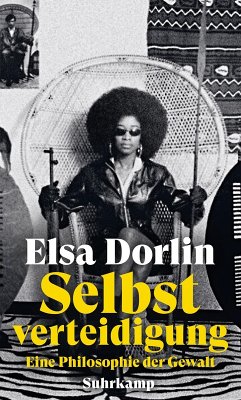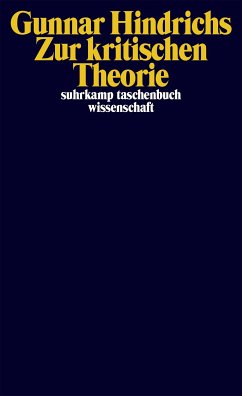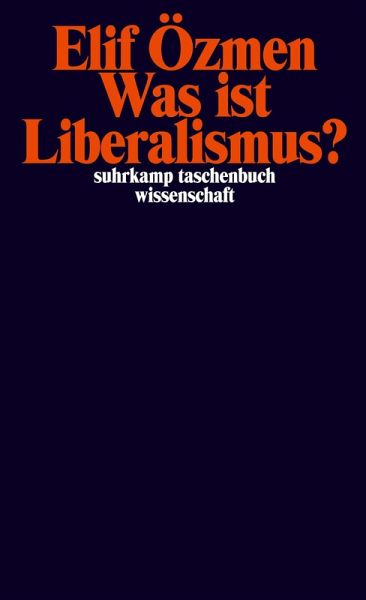
Was ist Liberalismus? (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 18,00 €**
17,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wer über Demokratie spricht, darf über Liberalismus nicht schweigen. Liberale Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Menschenrechte und Toleranz gehören zum festen Bestand moderner Demokratien. Daher ist die gegenwärtig vielbeschworene Krise der Demokratie auch eine Krise des Liberalismus. Dieser könne, so meinen viele, seine Versprechen nicht mehr einlösen. Gegen die allzu geläufigen Gemeinplätze und Krisendiskurse über den Liberalismus positioniert sich das Buch Elif Özmens mit einer systematischen Darstellung seiner philosophischen Grundlagen, normativen Architekture...
Wer über Demokratie spricht, darf über Liberalismus nicht schweigen. Liberale Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Menschenrechte und Toleranz gehören zum festen Bestand moderner Demokratien. Daher ist die gegenwärtig vielbeschworene Krise der Demokratie auch eine Krise des Liberalismus. Dieser könne, so meinen viele, seine Versprechen nicht mehr einlösen. Gegen die allzu geläufigen Gemeinplätze und Krisendiskurse über den Liberalismus positioniert sich das Buch Elif Özmens mit einer systematischen Darstellung seiner philosophischen Grundlagen, normativen Architekturen und aktuellen Kontroversen. Eine Verteidigung des Liberalismus als der am wenigsten schlechten unter den Regierungs- und Lebensformen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.