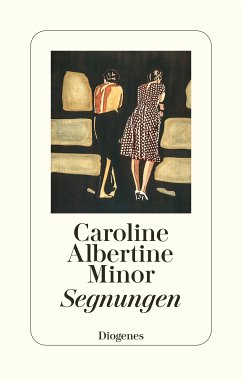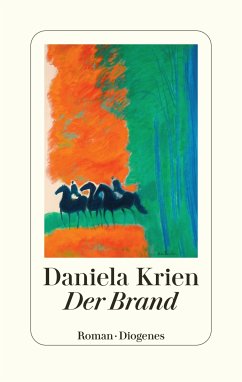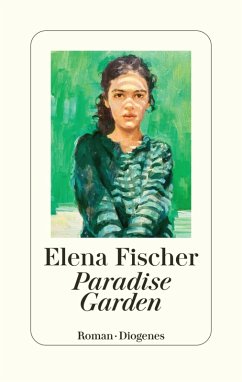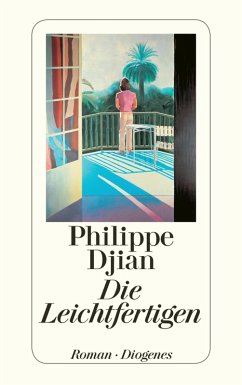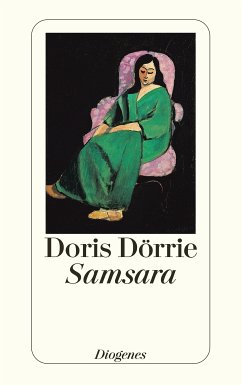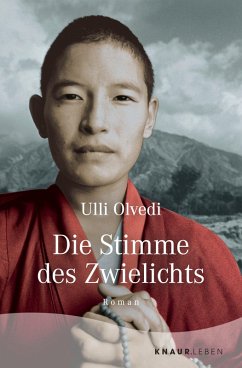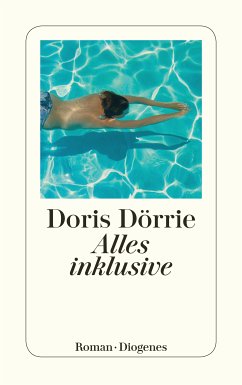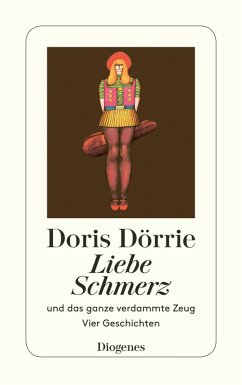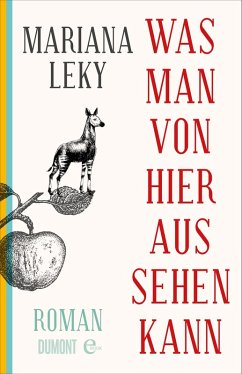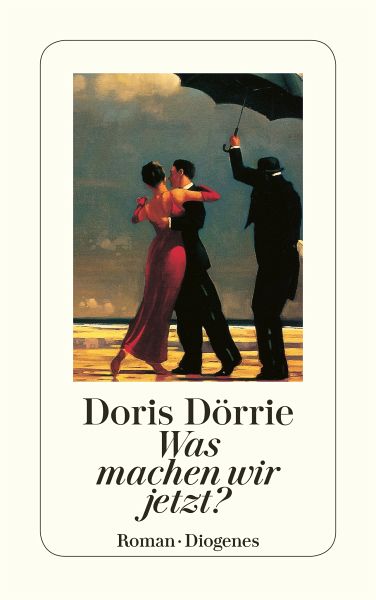
Was machen wir jetzt? (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 12,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wie weiter, wenn die Frau ihr Heil im Buddhismus sucht, die siebzehnjährige Tochter mit einem tibetischen Lama auf und davon will und einen selbst Geld und Erfolg nicht glücklich machen? Diese Fragen stellt sich nicht nur Doris Dörries Romanfigur Fred Kaufmann. Doch die Autorin zeigt uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Nur Mut, es gibt ein Leben über vierzig!
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.