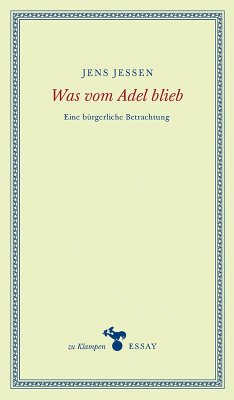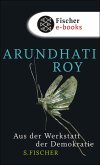Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Vor hundert Jahren wurde der Adel in Deutschland rechtlich abgeschafft. War das eine gute Idee? Jens Jessen erstattet Verlustanzeige und kommt zu weiterführenden Befunden.
Die Regenbogenblätter haben ihn immer geliebt, den Adel. Mittlerweile tut dies auch die Forschung, nunmehr auch zum neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert, in England lange schon, neuerdings auch in Frankreich (Éric Mension-Rigau). Und nun kommt ein wohltuend knapper Essay von hundert Seiten daher, zum hundertsten Jubiläum der rechtlichen Abschaffung in Deutschland geschrieben, der ihm mehr als Sympathie entgegenbringt, ja sogar feststellt, dass er eine Leerstelle in unserer Gesellschaft bezeichnet.
Mit einem sophistisch wirkenden Paukenschlag setzt der Essay ein: Langzeitarbeitslose, die sich in Hartz IV eingerichtet haben und diesen Lebensentwurf weitervererben, gleichen dem Adel, indem beide Gruppen das Prinzip der Leistungsverweigerung verinnerlicht haben. Das trifft den Adel heute aber nur insofern, als jeder Edelmann gegenwärtig eine Doppelexistenz führt: Im Berufsleben ist er Leistungsträger wie alle anderen auch (und keineswegs nur "Frühstücksdirektor"), als Mitglied seiner sozialen Gruppe aber hat er weder Arbeit noch Beruf, sondern ist, was er ist, und bleibt grundsätzlich unberührt von dem, was den Parvenu ausmacht: vom Bezug auf selbstverdientes Geld. Denn der Edelmann als solcher ist Erbe.
Jens Jessens Essay "Was vom Adel blieb" zitiert im Titel den berühmten Roman von Kazuo Ishiguro ("Was vom Tage übrig blieb", 1989), auch dies ein Abgesang, nämlich auf die britische Oberschicht aus der Sicht des loyalen Bediensteten. Auch Jessen pflegt Nostalgie (wie die Fernsehserie "Downton Abbey") und erstattet Verlustanzeige, sogar in doppelter Entbehrung. So wie der Adel entmachtet wurde, so auch sein Gegenspieler, das Bürgertum, das sogar, meint er, gänzlich verschwunden sei, während der Adel immerhin überlebt hat. Aus der Gegenüberstellung dieser beiden untergegangenen Führungsschichten bezieht der Essay seine Spannung, denn Jessen mag zwar dem gebildeten Bürgertum des achtzehnten Jahrhunderts und seinen emanzipatorischen Grundsätzen nachtrauern, dessen adelssehnsüchtiges Verhalten "erschütternd" finden und seinem Text den Untertitel "Eine bürgerliche Betrachtung" geben - Partei ist er aber nicht.
Autoritäten werden bei Jessen nur wenige genannt: Werner Sombart, José Ortega y Gasset, Herfried Münkler - Thorstein Veblen klingt wenigstens an, wenn vom demonstrativen Konsum des Adels die Rede ist, und auf die Romane Stendhals wird gerne Bezug genommen. Pierre Bourdieu jedoch fehlt, jener unerbittliche Kritiker verborgener Hierarchien und der Reproduktion von Ungleichheit. Öfter noch werden adlige Informantinnen genannt, wie im Ancien Régime üblich galant nur mit Initiale und drei *** bezeichnet.
Der Autor weiß Bescheid - allerdings: mit dem Ritterschlag wird man auf Lebenszeit Knight Bachelor, nicht erblich Baronet, der Esquire ist noch nicht Knight, und den Trachtenjanker trägt man auch beim Hochadel, kennt die Mechanismen der Inklusion und Exklusion, die seit undenklichen Zeiten dafür sorgen, dass schnell klar wird, wer dazugehört und wer nicht. Die Tatsache, dass es, wenigstens in den Republiken, seit 1918 keinen neuen Adel mehr gibt und im "Gotha" festgeschrieben ist, wer dazugehört, hat eine Schicht geschaffen, die seither abgeschlossen ist, keine Zugänge und kaum Abgänge kennt und aus natürlichen Gründen immer kleiner wird.
Ihr Prinzip ist Erblichkeit und ihr Wesen Sein, nicht Leistung und auch nicht Haben. Die enteigneten Edelleute Osteuropas mitsamt der ehemaligen DDR waren verarmt, haben Berufe ergriffen wie Anlageberater, Immobilienmakler, Kunstauktionator oder betreiben Großreinigungen und Großbäckereien. Nach wie vor gilt, nur "Groß" ist standesgemäß, echtes Handwerk an sich ist von Übel, obschon es inzwischen auch adlige Fußballprofis gibt. Nach wie vor ist es im Grunde unschicklich, einen Edelmann nach seiner Profession zu fragen.
In Adelskreisen bleibt Fürst Fürst, Graf Graf, Freiherr Freiherr und Uradel Uradel, wie unterschiedlich die Tätigkeiten und Vermögensverhältnisse auch sein mögen. Es ist überhaupt problematisch, von dem Adel zu sprechen (was der Autor wohl weiß). Jedenfalls wird der Rang von der wirtschaftlichen Lage nicht (mehr) beeinflusst. Allerdings: wenn das Schloss verkauft oder enteignet, das letzte Familienporträt, antike Möbelstück und wappengezeichnete Silberzeug verkauft ist und kein neues Geld hereinkommt, dann wird es kritisch, denn wie eh und je entscheidet der Lebensstil.
Aber auch während der Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts haben sich die Netzwerke, die Internationale bleue, bewährt, hat man einander geholfen und ist wieder aufgekommen, wie überhaupt der familiäre Zusammenhalt des Adels eine Tatsache ist und als vorbildlich gelobt wird. Im deutschen Süden, in Österreich - wo man von Otto Habsburg sprechen muss, so wie 1792 von Louis Capet - hat man die Krisen besser überstanden, so wie auch in Frankreich und in Großbritannien, allen Revolutionen zum Trotz.
Adligen shabby chic hält Jessen einerseits für Pose, andererseits für einen Wahrnehmungsirrtum: Wenn man die Wüstenpflanzen wieder (finanziell) bewässert, kehren sie zu "Prunk und Protz" zurück: "Der Adel braucht kein Understatement" und kann sich in den höchsten Rängen verhalten wie ein Popstar - was aber den stets vorhandenen gespaltenen Konsum verkennt: Schlichtheit im Alltag ("Die adlige Gesellschaft ist keine Wegwerfgesellschaft"), Aufwand dagegen bei Fest und Feier. Denn Ziel ist nicht der angesparte Aufstieg, da man in der Eigenwahrnehmung schon oben ist, sondern das schöne Leben im Kreise Gleichgesinnter. Das Gefühl der Langweile wird der bürgerlichen Welt zugeordnet, galt aber bislang als eine typisch aristokratische Krankheit.
Treffsichere Anekdoten und eine Prise Humor erfreuen den Leser. Aber es geht um eine ernste Sache. Wenn der Adel sich dem Leistungsprinzip verweigert, dann ist er ein Hort beneidenswerter Freiheit und Würde, überhaupt "eine Art genetisches Weltkulturerbe". Allerdings ist auch von einem "Opportunismus der Gene" die Rede, der stets der Außenlenkung der bürgerlich-gewissenhaften Innenlenkung den Vorzug gibt und deshalb sich hurtig mit dem Nationalsozialismus arrangierte - etwas schnell werden die zahlreichen Edelleute des 20. Juli 1944 als Ausnahme angesehen, denen die Aristokratie in dem Sinne "Verrat" vorwarf, als sie in der Tat ihre Familien gefährdeten. Aber auch die bürgerlichen Intellektuellen agierten als "Lakaien des Kapitals", heißt es. Die Ahnengalerie macht als geronnene Zeit nicht nur Kontinuität und Identität sichtbar, sie dient auch als furchterregender Aufruf, es den Vorfahren gleichzutun.
Dass der Adel als Gruppe überlebt hat und immer noch sozial-symbolisches Kapital besitzt, zeugt von seiner Lebenskraft, auch die tatkräftige Rückkehr in den ehemaligen Besitz tut es. Und schließlich: Was wäre Europa ohne das kulturelle Erbe jener anscheinend nonchalanten Damen und Herren, die in unbarmherziger Konkurrenz um Ehre und Ruhm zu Mäzenen wurden, deren Aufträge wir heute oft genug als Welterbe verehren und wirtschaftlich ausbeuten?
Nicht ganz zu Recht wird dabei der Anteil der Reichs-, Frei- und Hansestädte vernachlässigt, deren Oberschichten zwar fast alle nach dem Adel strebten (aus dem sie oft genug ursprünglich auch kamen), die aber als herrenmäßiges Kollektiv doch ein republikanisches Bewusstsein entwickelt haben, das schließlich die Oberhand behalten hat, auch wenn nicht sie es waren, die ihm zum Durchbruch verholfen haben. Und dem heutigen Beobachter ist nicht ganz wohl angesichts der sozialen Kosten des Dresdener Elbufers oder des riesenhaften Mannheimer Schlosses, von Versailles ganz zu schweigen. Moralismus und Einfühlsamkeit sind jedoch, wie Leonhard Horowski gezeigt hat, zutiefst unaristokratisch: Die Schillersche Unterscheidung von naiver und sentimentalischer Dichtung begegnet uns hier wieder.
Die Summe des Büchleins steht genau in seiner Mitte und ist ebenso provokant formuliert wie der Anfang: "Es ist mit wie mit den Sitten und Gebräuchen indigener Völker im Regenwald: Sie bewahren alternative Techniken und Möglichkeiten des Menschseins, auf die man, wer weiß, eines Tages angewiesen sein könnte, wenn alles andere gescheitert ist." "Das unverlierbare Erbe" heißt denn auch das abschließende Kapitel und der letzte Satz lautet: "Vom Adel blieb, dass er der Gesellschaft zu fehlen begann, kaum dass er abgetreten war." Der Adel als Alternative und Katastrophenschutz? Wenn wirklich die nächste Generation das Kite-Surfen auf den Bahamas dem Erhalt ihres kulturellen Erbes vorzieht, dann wird daraus nichts.
WERNER PARAVICINI
Jens Jessen: "Was vom Adel blieb". Eine bürgerliche Betrachtung.
Zu Klampen Verlag, Springe 2018. 101 S., geb., 16.- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main