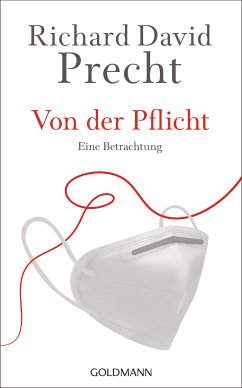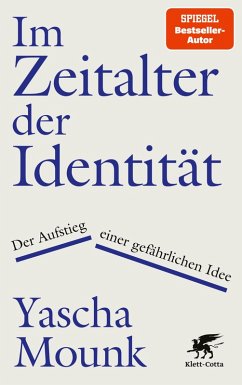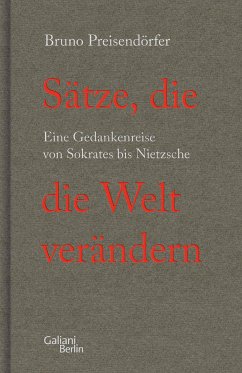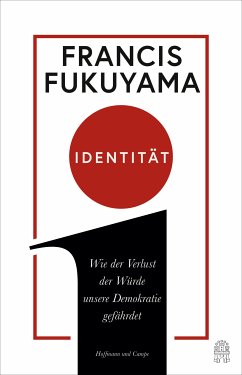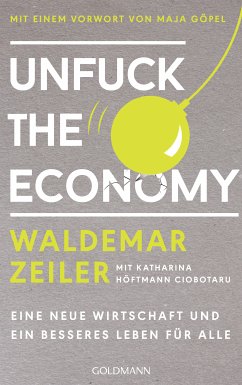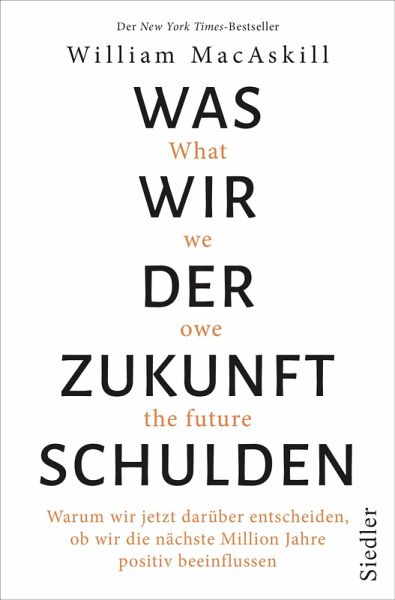
Was wir der Zukunft schulden (eBook, ePUB)
Warum wir jetzt darüber entscheiden, ob wir die nächste Million Jahre positiv beeinflussen - New York Times-Bestseller
Übersetzer: Neubauer, Jürgen
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wie wir mit den richtigen Entscheidungen den Enkeln unserer Enkel ein Leben in Sicherheit und Glück ermöglichen »Dieses Buch ist ein monumentales Ereignis.« Rutger Bregman Der britische Philosoph und Aktivist Will MacAskill fordert ein radikal neues Denken beim Thema Nachhaltigkeit: Unser heutiges Handeln muss nicht nur die Konsequenzen für die nächsten Generationen miteinbeziehen, sondern auch die Folgen für die Menschheit in einer weit entfernten Zukunft. Es reicht nicht aus, den Klimawandel einzudämmen oder die nächste Pandemie zu verhindern. Wir müssen sicherstellen, dass sich di...
Wie wir mit den richtigen Entscheidungen den Enkeln unserer Enkel ein Leben in Sicherheit und Glück ermöglichen »Dieses Buch ist ein monumentales Ereignis.« Rutger Bregman Der britische Philosoph und Aktivist Will MacAskill fordert ein radikal neues Denken beim Thema Nachhaltigkeit: Unser heutiges Handeln muss nicht nur die Konsequenzen für die nächsten Generationen miteinbeziehen, sondern auch die Folgen für die Menschheit in einer weit entfernten Zukunft. Es reicht nicht aus, den Klimawandel einzudämmen oder die nächste Pandemie zu verhindern. Wir müssen sicherstellen, dass sich die Menschheit nach einem Kollaps auch wieder erholt. Ein Manifest von enormer Sprengkraft - minutiös recherchiert und brillant geschrieben.
Mit zahlreichen Abbildungen und Grafiken.
Mit zahlreichen Abbildungen und Grafiken.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.