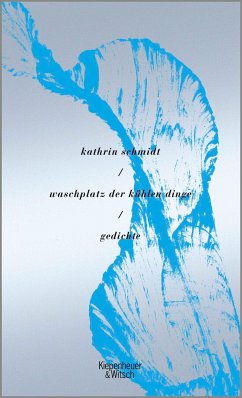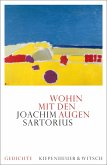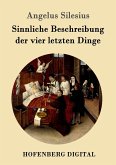Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Sprachhaut abtasten: Kathrin Schmidts Lyrik sucht den "waschplatz der kühlen dinge".
Von Angelika Overath
Was heißt verstehen? Wenn verstehen heißt, etwas erklärend in eigenen Worten sagen zu können, dann sind Kathrin Schmidts Gedichte nicht verständlich. Und doch handelt jedes von Phänomenen, die im Horizont des Alltags liegen: Älterwerden, Naturerfahrungen, Reiseimpressionen, die Gleichzeitigkeit von Partylaune und Ertrinken an schönen Stränden. Und im "wüten washingtons" ertönt die "trumpet". Erleben, Erinnern, Empfinden, Überlegen werden von Kathrin Schmidt nicht einfach (oder kompliziert) in eine sprachliche Form gebracht. In dieser Lyrik meldet sich Sprache als ein Gegenüber, mit dem die Autorin interagiert: sensibel, heftig, spöttisch, sarkastisch, witzig und manchmal brutal.
Es ist wie ein Abtasten, ob die Sprachhaut reagiert, empfindlich wird und antwortet. Stimuliert von Realitätspartikeln oder Redensarten oder nur von einzelnen Wörtern, kann die Autorin in einen flow geraten, in eine Art vom wortkörperlichem Zusammensein mit Silbenfall und Gleichklängen. Konsequente Kleinschreibung, bei dem die grammatikalischen Ordnungen ins Fließen geraten, unterstreichen das Fluide dieses Geschehens. Und wie beim Sex (oder schon beim Purzelbaum) ist hier nicht jede Sprachbewegung "verständlich". So können Sätze mehr oder weniger notwendig der Kontrolle einer Verstehens-Vernunft entgleiten. Ihre Intimität ist nicht immer teilbar.
Beschreibbar sind die Gedichte schon. Das titelgebende Eingangsgedicht "verfallen" öffnet für dreimal sechs Zeilen eine Naturszene: "im unruhigen garten der mohn kopf an kopf". Von Enkeln ist die Rede, denen Kletten - "frisch installiert / die widerborsten" - im Haar hängen, oder sie hängen im Haar der Ich-Großmutter: "falls ich ins gras falle. falls ich die falle / der zündschnüre nicht umgehen kann." Kampfmetaphorik unterläuft die kleine Idylle, explosionsbereit. In diesem Garten "zeltet die verpflichtung zum zeithaben, zum ausharren". Aber das Ich rüttelt an den Stangen (von Zelt und Zeit). Es sagt von sich, dass es "wie toll" aussehen muss, in dieser Ekstase. Und doch hat es im sommerlichen Ambiente einen "strengen winter / um den mund". Sein "eisiger standpunkt / tritt sehr beherrscht auf und ködert die temperaturen". Dieser Sommergarten wird zum "waschplatz / der kühlen dinge", die das Ich "mitnehmen will, während im zelt / die schuldigkeit langsam dahingeht".
Das ist programmatisch. Ein Ich hat einen Waschplatz errichtet, an dem die Dinge kühl gehalten, gereinigt werden von Erhitzung. Dabei ist dieses Ich zum einen außer sich, "wie toll", zum andern "ködert" sein "eisiger standpunkt" die Temperaturen. Ob es über die Zündschnüre des Sommers "fällt" oder nicht, es bleibt (dem Leben, der Liebe, der Aufmerksamkeit, dem Dasein?) "verfallen".
Ein sicherer Weg, Temperaturen zu drosseln, ist die Form. Die strengste poetische Struktur dürfte der Sonettenkranz verlangen, eine Versbastelanleitung aus dem Barock, bei dem die letzte Zeile eines Sonetts zur ersten des nächsten wird. Nach vierzehn Gedichten (die den zweimal vier plus zweimal drei Zeilen eines Sonetts entsprechen) bildet ein fünfzehntes Sonett mit der Abfolge der jeweiligen vierzehn Anfangsverse den Abschluss. In "das boot setzt über" fügt Kathrin Schmidt in dieser Weise streng gegliedert unterschiedliche Themen zusammen, die sich mischen und verändern in schwindelmachenden Echos. Sie überblendet die Frage nach dem Übersetzen wie nach dem Schreiben mit Flüchtlingsbooten, die übersetzen zu einem Ufer. Und auch ein "lieblingsfisch" durchschwimmt die Klangwasser; er kennt das "salz der salze noch vom balzen". In diesen hochartistischen Stücken geht es um Poesie und Politik, Erotik, Leibesund Sprachaufschwünge, die bei dieser realitätswachen und lebenserfahrenen Autorin voneinander nicht zu trennen sind. Und ist es dann schlimm, wenn der "altgewordene uterus ulkt", vielleicht nur um des Klanges willen, und auch die "migränenmoräne" und die "kürzeldrüse" aus diesem Grund ihren Auftritt haben?
Am schönsten sind die Reisegedichte. Sie fangen Augenblicke von oft unaussprechlichen Orten ein, und ein Reporterblick durchblitzt sie. Sie führen zur mexikanischen Kreispyramiden-Kultanlage "Los Guachimontones" oder - im Gedicht "paleski radyaytsina-ekalagichny, pogonnoye" - zum radioaktiv verseuchten "schlackenland" eines Nationalparks in Weißrussland. Dann wieder nehmen sie mit zum Picknik in Rjasan: "die vielstimmige wiese auf dem tisch, das azurblaue / wispern der gläser, gäste mit taschentüchern aus mohn -".
Blau ist eine kalte Farbe. Sie durchzieht diese Verse, "die sich im abend kühl herunterdimmen", immer wieder einmal. Sie verrät, dass bei aller Sozialkritik und politischer Haltung ein romantisches Band, ein Sehnen diese im Wechsel der Töne verwirrend und beglückend reiche Lyrik färbt. Im letzten Gedicht "amazonian amazon" legt denn auch das Ich "die weibliche endung beiseite". Um dann "dem e hinterher" zu schauen: "meinem/ blauen, so blauen begehr."
Kathrin Schmidt: "waschplatz der kühlen dinge". Gedichte.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018. 93 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH