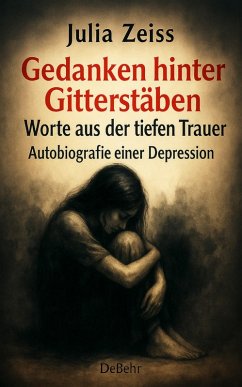Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein (eBook, ePUB)
Vom Leben mit Depressionen
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 13,00 €**
12,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Als ich wieder gesund bin, will ich Friederike erklären, wie Depressionen sind. Aber Depressionen sind geschickt. Ist man gesund, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie es war, krank zu sein. Und ist man krank, kann man sich nicht vorstellen, je wieder gesund zu werden.«Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein ist ein entwaffnend ehrliches Zeugnis vom Leben mit Depressionen. Benjamin Maack ringt der unbarmherzigen Krankheit tragikomische Momente ab und erzählt von ihr in so berührenden wie klaren Bildern. Seine Geschichte ist aber nicht nur Psychiatrie- und Krankenbericht,...
»Als ich wieder gesund bin, will ich Friederike erklären, wie Depressionen sind. Aber Depressionen sind geschickt. Ist man gesund, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie es war, krank zu sein. Und ist man krank, kann man sich nicht vorstellen, je wieder gesund zu werden.«
Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein ist ein entwaffnend ehrliches Zeugnis vom Leben mit Depressionen. Benjamin Maack ringt der unbarmherzigen Krankheit tragikomische Momente ab und erzählt von ihr in so berührenden wie klaren Bildern. Seine Geschichte ist aber nicht nur Psychiatrie- und Krankenbericht, sondern auch Familiendrama und die Erzählung eines persönlichen Schicksals. Ein schonungsloses, literarisch kraftvolles Buch.
Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein ist ein entwaffnend ehrliches Zeugnis vom Leben mit Depressionen. Benjamin Maack ringt der unbarmherzigen Krankheit tragikomische Momente ab und erzählt von ihr in so berührenden wie klaren Bildern. Seine Geschichte ist aber nicht nur Psychiatrie- und Krankenbericht, sondern auch Familiendrama und die Erzählung eines persönlichen Schicksals. Ein schonungsloses, literarisch kraftvolles Buch.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.