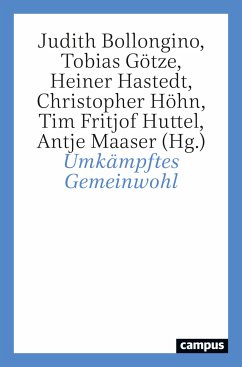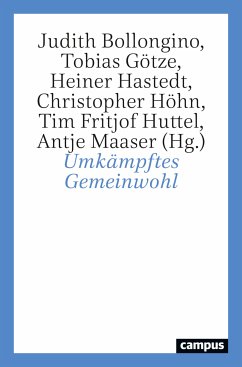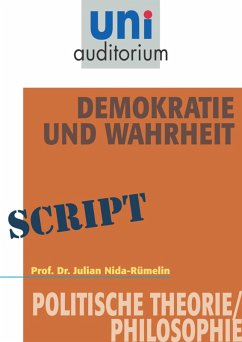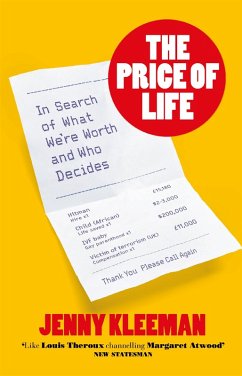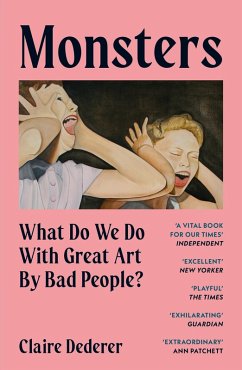Wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht (eBook, ePUB)
Streitschrift für ein neues Wir
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
17,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Jan Skudlarek lädt uns dazu ein, das Kindergartenniveau aktueller liberaler Freiheitsvorstellungen zu überdenken. Es geht um nicht weniger als unsere Zukunft.« Max Czollek Ob Impfpflicht, Abtreibungsverbot, Wehrdienst oder Cannabislegalisierung - ethische Fragen betreffen uns alle. Allgemeinwohl vor Eigeninteresse? Oder: Mein Körper, meine Entscheidung? Der Philosoph Jan Skudlarek erörtert die großen Streitfragen unserer Gesellschaft, deckt gängige Irrtümer und falsche Argumentationen auf und entwirft so eine konkrete Handreichung für solidarisches Handeln im Zeitalter der Krisen. V...
»Jan Skudlarek lädt uns dazu ein, das Kindergartenniveau aktueller liberaler Freiheitsvorstellungen zu überdenken. Es geht um nicht weniger als unsere Zukunft.« Max Czollek Ob Impfpflicht, Abtreibungsverbot, Wehrdienst oder Cannabislegalisierung - ethische Fragen betreffen uns alle. Allgemeinwohl vor Eigeninteresse? Oder: Mein Körper, meine Entscheidung? Der Philosoph Jan Skudlarek erörtert die großen Streitfragen unserer Gesellschaft, deckt gängige Irrtümer und falsche Argumentationen auf und entwirft so eine konkrete Handreichung für solidarisches Handeln im Zeitalter der Krisen. Vor über vierzig Jahren erschien das Hauptwerk des Philosophen Hans Jonas, in dem er sich damit beschäftigt, wo die Freiheit des Einzelnen endet: Das Prinzip Verantwortung. Heute ist die Frage nach Freiheit und Verantwortung brennender denn je - und gleichzeitig ungelöst. Was ist das eigentlich, Verantwortung? Warum fällt sie uns so schwer? Und wieso ist eben nicht an alle gedacht, wenn jeder an sich denkt? Ebenso wie ein Mensch mehr ist als die Summe seiner Zellen und eine Stadt mehr als die Summe ihrer Häuser, zeigen uns die gegenwärtigen Krisen, dass die menschliche Gemeinschaft mehr ist als die bloße Summe ihrer egoistischen Individuen. Doch wie gelingt gesellschaftlicher Zusammenhalt in Krisenzeiten? Jan Skudlarek entwirft in diesem Buch ein neues Wir: eines, das sich mit unserem Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung vereinen lässt. Eines, das solidarisch ist. Ein Wir, das trägt und verbindet, statt ausgrenzt und spaltet. »Wenn Freiheit toxisch wird, ist Solidarität die Antwort. Jan Skudlarek entwirft einen neuen Freiheitsbegriff, der uns durch die Krisen unserer Zeit navigiert. Ein kluges, differenziertes Buch.« Pia Lamberty
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.