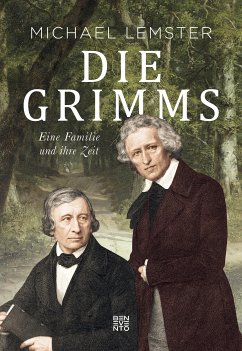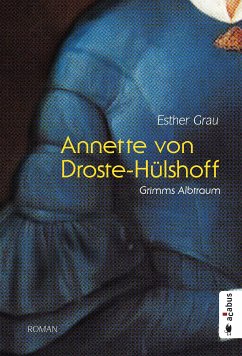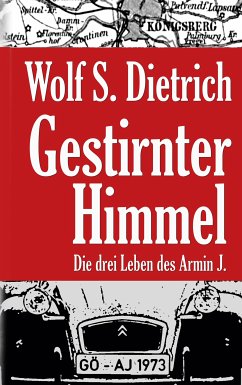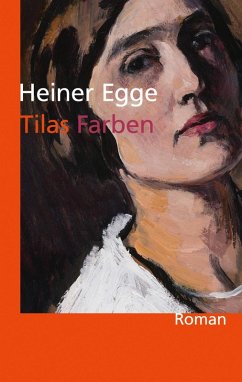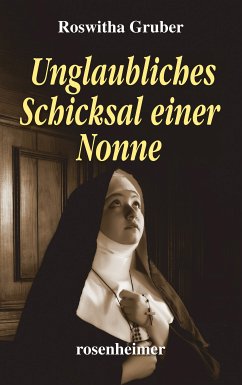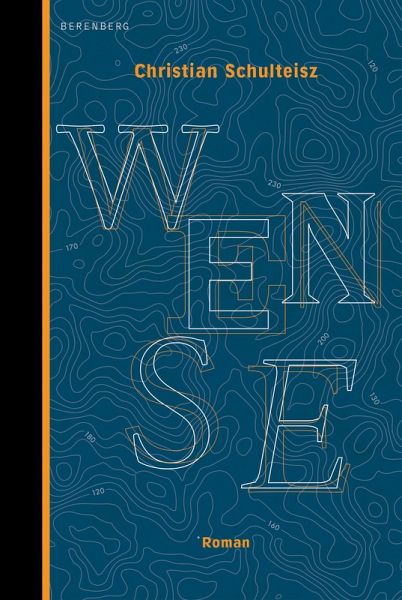
Wense (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Universaldilettant Wense wandert so, wie er forscht, übersetzt und komponiert: ekstatisch. Deutsche Landschaften sind ihm ebenso heilig wie die Sagen und Mythen der Cherusker, Maya oder Osmanen, wie Sterne, Steine und Tiere und all das andere, was es zu entdecken gilt. Allerdings herrscht Krieg, sein geliebtes Kassel wurde schon zerbombt, und in Göttingen muss er neuerdings Sonden für den militärischen Wetterdienst prüfen ... Angelehnt an die historische Person Hans Jürgen von der Wense erzählt Christian Schulteisz von einem allwissenden Taugenichts, der plötzlich taugen soll. Ein ...
Der Universaldilettant Wense wandert so, wie er forscht, übersetzt und komponiert: ekstatisch. Deutsche Landschaften sind ihm ebenso heilig wie die Sagen und Mythen der Cherusker, Maya oder Osmanen, wie Sterne, Steine und Tiere und all das andere, was es zu entdecken gilt. Allerdings herrscht Krieg, sein geliebtes Kassel wurde schon zerbombt, und in Göttingen muss er neuerdings Sonden für den militärischen Wetterdienst prüfen ... Angelehnt an die historische Person Hans Jürgen von der Wense erzählt Christian Schulteisz von einem allwissenden Taugenichts, der plötzlich taugen soll. Ein tragisch-komischer Roman über Poesie und Irrsinn einer staunenden, zweckfreien Sicht auf die Welt. "Christian Schulteisz ist ein eindringlich schreibender Zeitgenosse." Arnold Stadler
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.