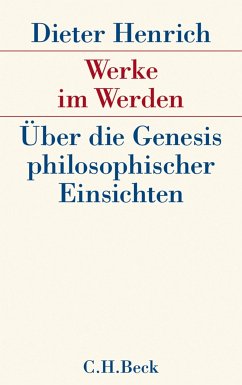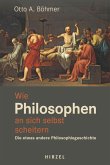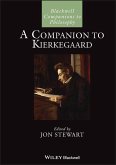Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Behutsame Vergewisserung und großes Begriffstheater zugleich: Dieter Henrich macht in seinem neuen Buch die Verlustrechnung auf, wenn das Erbe der Philosophie ausgeschlagen wird.
Ob philosophische Entwürfe zu wirklicher Erkenntnis führen, ist eine recht groß zugeschnittene Frage. Ihre Beantwortung hängt davon ab, welche Ansprüche man mit "wirklicher" Erkenntnis verbindet. Was natürlich selbst wieder auf philosophische, also auf grundsätzliche Fragen hinausläuft, in denen kein Verweis auf etablierte Terrains des Wissens weiterhilft - und nicht zuletzt auf die Frage zusteuert, was es mit der Philosophie im Kern eigentlich auf sich habe.
Wesensbestimmungen des Philosophischen, die von den Vorsokratikern bis Derrida oder Habermas halten sollen, sind freilich meist eine schale Angelegenheit. Verständlich also, dass manche sich darum bemühen, die Sache eher pragmatisch anzugehen: Eine Tradition kanonischer philosophischer Autoren gebe es nun einmal, aber ihr verbindendes Element liege durchaus nicht in einem sich durchhaltenden Problembestand, an dem alle diese Philosophen sich abarbeiteten. Viel eher gelte es, im Rückblick die Differenzen zu erkennen, an den ganz anderen Problemlagen und Verfahrensweisen einen Geschmack für die historische Variabilität unserer eigenen Sichtweisen auszubilden.
Richard Rorty war ein prominenter und entschiedener Vertreter solcher Umgehung eines vermeintlichen philosophischen Kernbestands: Er sah in den kanonisierten Philosophien vielmehr die Arbeit an der Verknüpfung von verschiedenen Wissensansprüchen ihrer Zeit, die es in den breiteren Kontext kultureller Umwälzungen zu stellen gilt. Womit die Philosophie zu einer Facette dieses kulturellen Lebens unter anderen wird: Ihre unbedingten Begründungsansprüche mögen wertvolle Anstöße geben, aber als bare Münze sind sie gerade nicht zu nehmen. Außerdem wissen wir einfach eine Menge Dinge mehr von der Welt als Descartes, Kant oder Hegel - und das sticht letztlich auch in Sachen einer ins Ensemble der intellektuellen Verständigungen über die Welt eingegliederten Philosophie.
Es liegt fast auf der Hand, dass ein Philosoph wie Dieter Henrich, an der nachkantischen Entwicklung hin zu den idealistischen Systementwürfen orientiert, diese pragmatische Auskunft unzureichend findet. So wie andere Versuche auch - er nennt im Vorbeigehen den Ideengeschichtler Quentin Skinner und Michel Foucault -, philosophische Konzeptionen strikt an bestimmte kulturelle oder "epistemische" Ausgangslagen und auf sie reagierende Interventionsabsichten rückzubinden. Natürlich sei das immer möglich, lasse sich auch durchaus aufschlussreich durchführen - aber an den großen philosophischen Entwürfen bleibt für Henrich damit ein Mehrwert unberücksichtigt, der nicht als bloß rhetorischer Überschuss zu kappen, sondern vielmehr als das eigentliche philosophische Moment ernst zu nehmen ist.
Nun ist Dieter Henrich aber auch ein Philosoph, bei dem man nicht befürchten muss, dass er diesen Mehrwert einfach in eine hübsche Formel bannt oder schlicht die "philosophia perennis" als Instanz der Verhandlung ewiger Menschheitsfragen beschwört. Zwar, ohne eine Grundbestimmung philosophisch genannter Einsichten geht es nicht ab. Aber diese Bestimmung wird nicht Werken abgelesen, sondern soll über eine Betrachtung von Initialeinsichten erreicht werden, die am Beginn des Weges zu diesen Werken stehen. Wobei durchaus nicht ausgemacht ist - Heidegger und Wittgenstein sind die prominenten Fälle des letzten Jahrhunderts -, dass die ins Auge gefassten Darstellungen auch wirklich zustande kommen.
Einige Berichte von solchen plötzlichen Durchbrüchen zu einer Grundeinsicht lässt Henrich Revue passieren: Rousseau ist darunter, in dem die Lektüre einer akademischen Preisaufgabe den Grundgedanken seiner Kulturkritik aufscheinen lässt; Descartes Traumorakel eines neuen sicheren Wegs, von dem sein Biograph zu berichten weiß; Fichtes aufblitzende Einsicht von dem im Ich verankerten höchsten Prinzip der Philosophie, Nietzsches Zarathustra-Moment oder Wittgensteins Evidenzerlebnis über die Möglichkeit einer Religion beim Besuch einer Theateraufführung.
Diese Zeugnisse sollen illustrieren, dass die plötzliche Einsicht in die Möglichkeit, aus Einseitigkeiten philosophischer Grundpositionen herauszukommen, mit der Begründung einer neuen Lebensweise einhergeht: Zum Grundgedanken tritt eine Orientierung des Lebens - und liege sie auch, wie bei Wittgenstein, in der Evidenz, dass die Lösung der philosophischen Probleme jene des Lebens unberührt lässt.
Die Berichte sind freilich recht disparat und fungieren auch eher als Illustration für den grundlegenden Anstoß, um den es Henrich zu tun ist: Denn aus ihm sollen sich Form und inhaltliche Ausgestaltung der jeweiligen philosophischen Werke entwickeln lassen. Eine Aufgabe, die Henrich zur Aufgabe einer "Literaturgeschichte der Philosophie" erklärt. Die Nähe der zum Ausgangspunkt genommenen Grundeinsichten zu plötzlichen religiös geprägten Initialmomenten entgeht Henrich dabei durchaus nicht. Sie steht bei ihm vielmehr für einen gemeinsamen Bezug auf einen letzten Grund, von dem für ihn auch die Philosophie nicht lassen kann, selbst wenn sie ihn in ihren Entwürfen ganz anders entfaltet.
Dir Rückbindung des aufblitzenden Grundgedankens an eine Lebensorientierung mag auf den ersten Blick wie die Auslieferung an einen höchst subjektiven Erlebnischarakter scheinen. Aber gerade sie ist es, auf die Henrich seine Argumentation baut, dass die Kopplung von ursprünglicher Einsicht und letzthin Gründendem einer bewusstem Lebensführung ein Bestimmungsstück von Philosophie an die Hand gibt, das alle kulturelle Besonderheiten ihrer Ausformung übersteigt. Und auch von der Tatsache nicht relativiert werden kann, dass die damit ins Auge gefassten philosophischen Grundentwürfe einander flagrant widersprechen: Es ist behutsame Vergewisserung und großes Begriffstheater zugleich, wie Henrich auf knappem Raum seinen Weg findet zwischen einer unhaltbaren Verpflichtung auf Fortschritt in Sachen philosophischer Grundfiguren auf der einen und der allzu selbstbewussten Hegelschen Option auf die erreichte Stillstellung im Zeichen der vollendeten Historisierung auf der anderen Seite. Er optiert letztlich für das unbeendbare Schwanken zwischen Grundpositionen, deren Einseitigkeiten zwar zutage liegen, die aber von dem um ein gründendes Einheitsmoment bemühten philosophischen Impuls gar nicht vermieden werden können.
Viele große Worte, werden pragmatischer an den philosophischen Kanon herangehende Kritiker wohl einwenden. Aber selbst wer ihnen zuneigt, wird die Sogkraft von Henrichs Argumentationsgang nicht in Abrede stellen wollen, in dem die Kautelen des bloß Propädeutischen und Skizzenhaften der Prägnanz der Darstellung eher zuwachsen als sie schmälern. Es geht darin auch einmal mehr darum, eine in den großen Systementwürfen umrissene Bestimmung von Philosophie im Spiel zu halten, weniger direkt ihre Vorzüge anzupreisen, als vielmehr eine Verlustrechnung anzudeuten, wenn das Erbe des in ihnen erreichten Problembewusstseins ausgeschlagen wird. Ohne Umwege philosophiert man auf diesem Niveau nicht - und selten findet man sie so wohlüberlegt angelegt und konzis formuliert wie in diesem schmalen Band.
HELMUT MAYER
Dieter Henrich: "Werke im Werden". Über die Genesis philosophischer Einsichten.
Verlag C. H. Beck, München 2011. 216 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH