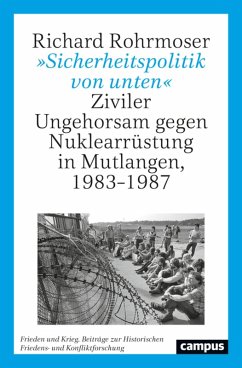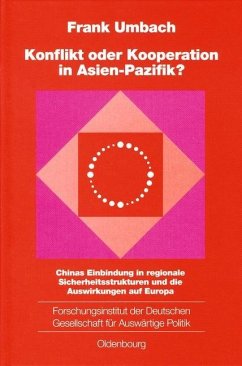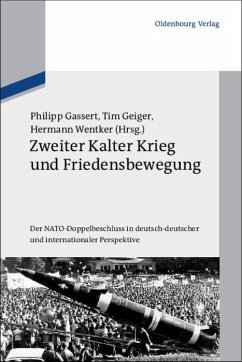Westbindung oder Gleichgewicht? (eBook, PDF)
Die nukleare Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland zwischen Atomwaffensperrvertrag und NATO-Doppelbeschluss
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
79,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Status der Bundesrepublik Deutschland als Nichtkernwaffenstaat und ihre faktische Position in der nuklearen Weltordnung zur Zeit des Ost-West-Konflikts standen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Dies zeigt auch die Geschichte der nuklearen Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren, die Andreas Lutsch in diesem Buch analysiert.Welche Interessen verfolgte Deutschland in Bezug auf die westliche Nuklearstrategie und die nukleare Rüstungskontrollpolitik, ohne Atommacht werden zu wollen? Wie veränderten sich Positionen, Ziele und Interessendefinit...
Der Status der Bundesrepublik Deutschland als Nichtkernwaffenstaat und ihre faktische Position in der nuklearen Weltordnung zur Zeit des Ost-West-Konflikts standen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Dies zeigt auch die Geschichte der nuklearen Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren, die Andreas Lutsch in diesem Buch analysiert.
Welche Interessen verfolgte Deutschland in Bezug auf die westliche Nuklearstrategie und die nukleare Rüstungskontrollpolitik, ohne Atommacht werden zu wollen? Wie veränderten sich Positionen, Ziele und Interessendefinitionen in der deutschen nuklearen Sicher heitspolitik? Wie wurden die deutschen Interessen von den USA eingeschätzt? Wie entwickelte sich die Position der Bundes republik in der NATO? Und welche Rolle spielte Ihr Status als Nichtkernwaffenstaat? Diesen Fragen zur deutschen »Nukleardiplo matie« geht der Autor multiarchivarisch abgestützt auf den Grund.
Welche Interessen verfolgte Deutschland in Bezug auf die westliche Nuklearstrategie und die nukleare Rüstungskontrollpolitik, ohne Atommacht werden zu wollen? Wie veränderten sich Positionen, Ziele und Interessendefinitionen in der deutschen nuklearen Sicher heitspolitik? Wie wurden die deutschen Interessen von den USA eingeschätzt? Wie entwickelte sich die Position der Bundes republik in der NATO? Und welche Rolle spielte Ihr Status als Nichtkernwaffenstaat? Diesen Fragen zur deutschen »Nukleardiplo matie« geht der Autor multiarchivarisch abgestützt auf den Grund.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.