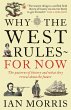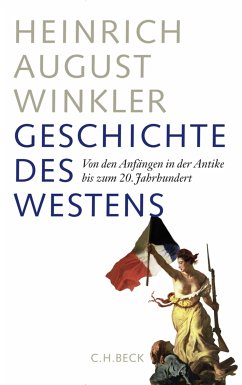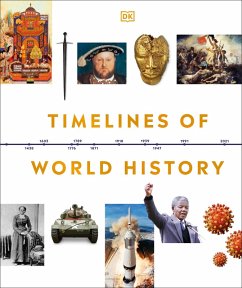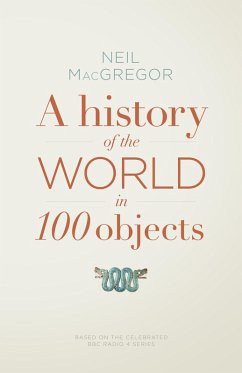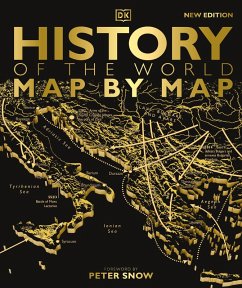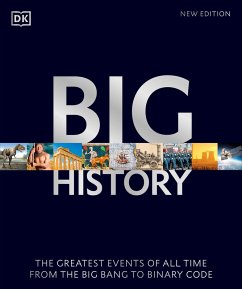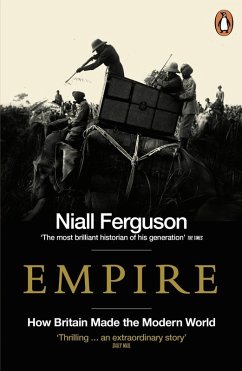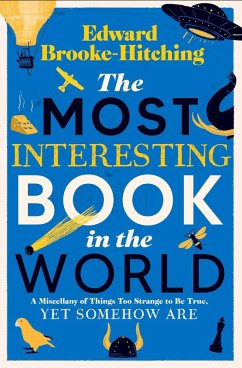Why The West Rules - For Now (eBook, ePUB)
The Patterns of History and what they reveal about the Future

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Why did British boats shoot their way up the Yangzi in 1842, rather than Chinese ones up the Thames? Why do Easterners use English more than Europeans speak in Mandarin or Japanese? To put it bluntly, why does the West rule? There are two schools of thought: the 'Long-Term Lock In' theory, suggesting some sort of inevitability, and the 'Short-Term Accident' theory. But both approaches have misunderstood the shape of history.Ian Morris presents a startling new theory. He explains with flair and authority why the paths of development differed in the East and West and - analysing a vicious twist ...
Why did British boats shoot their way up the Yangzi in 1842, rather than Chinese ones up the Thames? Why do Easterners use English more than Europeans speak in Mandarin or Japanese? To put it bluntly, why does the West rule? There are two schools of thought: the 'Long-Term Lock In' theory, suggesting some sort of inevitability, and the 'Short-Term Accident' theory. But both approaches have misunderstood the shape of history.
Ian Morris presents a startling new theory. He explains with flair and authority why the paths of development differed in the East and West and - analysing a vicious twist in trajectories just ahead of us - predicts when the West's lead will come to an end.
'Here you have three books wrapped into one: an exciting novel that happens to be true; an entertaining but thorough historical account of everything important that happened to any important people in the last 10 millennia; and an educated guess about what will happen in the future. Read, learn, and enjoy!' Jared Diamond
'A great work of synthesis and argument, drawing together an awesome range of materials and authorities to bring us a fresh, sharp reading of East-West relationships.' Andrew Marr
Ian Morris presents a startling new theory. He explains with flair and authority why the paths of development differed in the East and West and - analysing a vicious twist in trajectories just ahead of us - predicts when the West's lead will come to an end.
'Here you have three books wrapped into one: an exciting novel that happens to be true; an entertaining but thorough historical account of everything important that happened to any important people in the last 10 millennia; and an educated guess about what will happen in the future. Read, learn, and enjoy!' Jared Diamond
'A great work of synthesis and argument, drawing together an awesome range of materials and authorities to bring us a fresh, sharp reading of East-West relationships.' Andrew Marr
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.