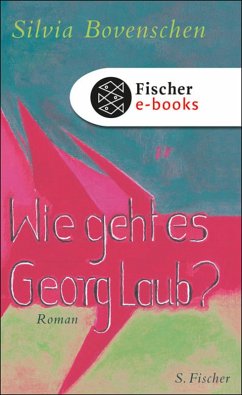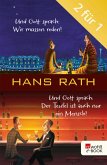Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Urlaub vom Netz: Silvia Bovenschen zeigt in ihrem Roman, was Aussteigen wirklich heißt. Nichts wie hinterher!
Von Oliver Jungen
Ein Mann verschwindet. Das heißt nicht, er wäre plötzlich nicht mehr da, im Gegenteil: das Verschwinden ist ein langer, schmerzlicher Prozess. Es ist auch ein Prozess im juristischen Sinn, der dem Verschwindenden gemacht wird, in dem die Anwälte des Lebens und des Lichts gegeneinander antreten und alle Gründe für und gegen die Teilnahme am irdischen Spektakel vorführen. Es gibt einen alten, kaum noch genutzten Raum für diesen Prozess, ein Wartezimmer für das Entschwinden.
Silvia Bovenschen, eine der wenigen echten Intellektuellen unter den deutschen Gegenwartsliteraten, die den großen, letzten Dingen in ihren Werken nie aus dem Weg geht, hat einen faszinierenden Roman über das Purgatorium verfasst. So anspruchsvoll wie leichthändig führt sie den Leser durch dieses Zwischenreich, das hier eine hochmoderne, digitale Komponente hat, aber auch eine ganz altertümliche Seite. Die am Saum dieser Welt Aufstellung nehmenden Freunde sorgen sich um das Seelenheil des Verschwindenden, beten für ihn, greifen sogar ein, aber schaudern zurück: Ihre Anteilnahme beschränkt sich mehr und mehr auf die Beobachtung und jene immer wieder gewälzte Frage, welche den Kreis ("eine Art Club") konstituiert: "Wie geht es Georg Laub?"
Wir beobachten die Beobachter und mit ihnen den Helden, Georg Laub, einen Schriftsteller, dessen Stern gesunken ist. Damit ist der Roman auch wieder Literatur zweiter Ordnung, Schreiben über das Schreiben. Der Leser begegnet dem Protagonisten als einem Abbitte Leistenden von geradezu mittelalterlichem Format, nicht eben an den nackten Fels gekettet wie Gregorius, aber so ähnlich: Georg bezieht ein heruntergekommenes, sterbendes Haus in Berlin, das er von seiner verblichenen Tante geerbt hat, verzichtet mit Ausnahme eines riesigen Flachbildschirms (der Apokalypsen zeigt) auf allen Luxus und beginnt ein mönchisches Leben: "Eine nahezu kultische Bedürfnislosigkeit." Aus dieser Tiefe, de profundis, ruft der Künstler die Wahrheit der Kunst an, will geläutert sein vom oberflächlichen Leben, das ihm noch vor Augen steht: "Jeder angesoffen oder zugekokst, jeder in der Positur maßloser Aufblähung, Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit."
Hier hockt er also, ein Eremit in schimmelnden Wänden, und übt Kulturkritik: "Ranking, wohin man auch schaltete. Schwachsinnig hierarchisierter Schwachsinn." Die Literatur scheint am Ende, spätestens seit der elektronischen Machtergreifung des Pöbels: "Jetzt stirbt das Autorentum den schleichenden Google-Tod." Das Symbol für die neue, glatte, dumme Welt ist für Georg der Potsdamer Platz; als reinste Verkörperung seiner Bewohner - "War er das, der neue Mensch?" - erscheinen ihm technologieversessene Ölscheichs. Seine Welt ist die der alten, hehren Kunst: "Er, Georg Laub, war ein Auslaufmodell." Es bleibt nur der totale Verzicht, das Martyrium der großen Verweigerung.
Der Rückzug hat schon stattgefunden, bevor der Roman einsetzt. Alle interaktiven Verbindungen sind gekappt, kein Internet, kein Telefon, keine Besuche - bis es dann doch plötzlich klingelt. Ein Freund aus der Vergangenheit taucht auf, Fred Mehringer, und mit ihm, trotz aller Abwehr, ein mächtiger Lebenswille. Georg hatte es sich zu einfach gemacht mit seiner Einsiedler-Romantik, denn jetzt erst beginnt die Zeit der Anfechtungen und Prüfungen, des Fiebers und des Schwindels, aber auch der Lust. Der Körper bäumt sich auf, setzt Begehren gegen Verwahrlosung: Georg verliebt sich in eine weitere Bewohnerin des Hauses, die merkwürdig unstoffliche Stella Remota, vertraut sich einem Arzt an, fürchtet den Tod, wirft sich in elegante Kleidung. Zugleich steigt die Sorge, sich wieder zu sehr dem Verachteten anzunähern: "Er war in dieser Straße längst kein Fremder mehr. Selbst schuld! Warum füllte er Formulare aus, ließ sich auf Gespräche ein, entwickelte Kneipenfreundschaften?"
Doch nicht nur für ihn, auch für uns sind die Freundschaften mit den Stammtischphilosophen Henry und Bernd, den Wirten Boris und Marlene oder den Ladenbetreibern Baumi und Alida Arnold willkommene Ablenkungen von der Thanatos-Melancholie. Überhaupt wird die Schwere der untergründigen Thematik durch Bovenschens erzählerische Eleganz aufgehoben, die eine entschiedene Neigung ins Diesseitige aufweist. Humorvolle Miniaturen blitzen immer wieder auf, etwa die Überlegung, wie sehr man sich zum Deppen macht, wenn man seinen Hund Kant genannt hat.
In eingeschalteten Ich-Erzählungen berichtet Georg von vier Prüfungen. Sie münden in vier von sonderbaren Gestalten gesungenen Tiraden gegen ihn, den gescheiterten Drachentöter. Eine Kunstrevolution nämlich hat der Protagonist erfolglos angezettelt, wollte mit Gleichgesinnten vorgehen gegen das "Ausdruckselend", gegen eine "Literatur, die nicht literarisch sein will", sondern das "Internetgeplapper" dupliziert. Der Rückzug war Folge dieses Scheiterns. Doch nun muss "der Netzphobiker" einsehen: "Es gibt keine zweite Naivität." Die Offline-Utopie ist reine Illusion. Hinter seinem Rücken wird Georg Laub "auf den Facebookmarktplätzen ausgestellt, beschimpft und verlacht". Aber damit ist er noch längst nicht am Ziel aller Erkenntnis, denn es geht in diesem Haus, das durch die Umstülpung aller Innen-Außen-Relationen gekennzeichnet ist, durchaus um ihn selbst. Wie haltbar ist sein Elitarismus? Klammert sich hier nicht einfach ein Schriftsteller alter Prägung an die falsche Askese?
Anklänge an die großen Erzähltraditionen der klassischen Moderne sind in Bovenschens Künstlerbuch nicht zu übersehen - ein wenig Klingsors letzter, rauschhafter Sommer weht hindurch, ein wenig Büßerpathos des Erwählten -, aber die gelehrte Intertextualität muss diesen ungemein souveränen Roman nicht tragen, sondern ist ein schönes und überdies ironisch gebrochenes Surplus. Denn natürlich geht es eigentlich, wie in jedem guten Roman, um die Liebe.
Silvia Bovenschen: "Wie geht es Georg Laub?" Roman.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011. 285 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH