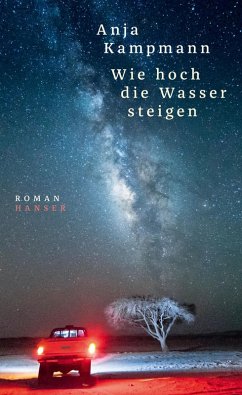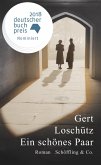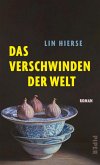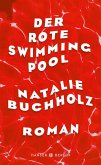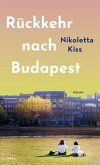Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Viel konkreter wird es nicht: In Anja Kampmanns Debütroman, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, irrt ein Ölbohrarbeiter ziellos durch Europa
Man muss es gar nicht erst nachschauen, es reicht, den Roman anzulesen, um zu wissen: Diese Frau ist Lyrikerin. Ebenfalls bei Hanser erschien 2016 ihr Gedichtband "Proben von Stein und Licht". Es geht sehr viel um Meer und Vögel, um Dörfer, Schnee und Wälder. Viel konkreter wird es nicht. Anja Kampmann verharrt im Vagen, das ist ihr Programm - und ihr Problem. Denn das Herumfühlen im Ungenauen liegt meist nur wenige Zentimeter neben dem Kitsch und kann für Leser, die sonst eher das Herumdenken im Präzisen schätzen, schnell unerträglich werden. Dem Kitschverdacht entgeht Anja Kampmann immer gerade so durch bewusstes Flachhalten sämtlicher sprachlicher Bälle. Und nimmt sich damit die Möglichkeit, auch nur einmal ein bisschen aufzudrehen und lauter zu werden und flüstert eben nur so vor sich hin. Aber von vorn.
In ihrem ersten Roman "Wie hoch die Wasser steigen", der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, geht es um einen 52 Jahre alten Mann, der auf einer Bohrinsel vor Marokko arbeitet. Dann stirbt sein Kollege und Freund Matyás bei einem Unfall, der nie aufgeklärt wird, was vor allem daran liegt, dass sich die Vorgesetzten wenig Mühe machen, irgendetwas aufzuklären. Matyás war nur globale Verschiebemasse im Energiegeschäft, ein Wanderarbeiter der besserbezahlten Sorte.
Der Ölbohrarbeiter heißt mal Waclaw und mal Wenzel, was schon gröbere Identitätsverwerfungen andeutet - denn wie heimatlos ist einer, der nicht einmal mehr weiß, wie er heißt? Er begibt sich nach Matyás Tod zunächst zu Patricía, Matyás Halbschwester, um ihr das letzte Bündel Hab und Gut zu übergeben. Er schläft mit ihr, das tut er öfter einmal am Wegesrand, und stellt dann fest, dass er nicht mehr auf die Plattform zurückkehren will, aber auch sonst wenig Ziele mehr hat. "Manchmal kam es ihm so vor, als wären diese Jahre davongerissen worden wie Brocken Ton von einer Töpferscheibe, die sie nur kurz berührten, und die Mitte der Scheibe bleibt leer."
Wer nicht weiß, wohin die Zukunft führt, der flüchtet sich gern einmal in die Vergangenheit. So auch Waclaw, der der Sohn eines polnischen Bergmannes im Ruhrgebiet war. Einer, der sich irgendwann zu Tode hustete, wie die meisten seiner Kollegen. Alois von der Esse hingegen kam rechtzeitig davon und bewohnt nun ein kleines Haus im Apennin. Über verschlungene Wege via Tanger, Malta, Norditalien, Orte, die allesamt eindruckslos vorbeiziehen, führt das Roadmovie Waclaw schließlich zum alten Alois, der noch immer seine Brieftauben züchtet wie damals. Und da bekommt er endlich eine Aufgabe. Er soll eine der Tauben mit ins Ruhrgebiet nehmen und sie dort freilassen. Denn die Brieftauben finden immer nach Hause, nur Waclaw nicht, weil er kein Zuhause hat, was jetzt nicht die subtilste Metaphorik ist, die einem dazu einfallen kann. Und auch Milena - von ihr erfahren wir immerhin, dass sie schön ist, kleine feste Brüste hat und einen Cockerspaniel - hat er irgendwann verloren, denkt aber ständig noch an sie.
Der Roman hat nichts von dem, was Romane normalerweise haben, es ist die lyrische Annäherung an einen Roman. Alles zieht in einem dissoziierten Irgendwo, einem Irgendwann an einem vorbei, vermutlich fühlt es sich so an, wenn man Waclaw ist, man nirgendwo hängenbleibt und auch nichts an einem selbst hängenbleibt. Was aber bleibt, das ist die Sprache, die ihre Gegenstände mit spitzen Fingern anfasst und es immerhin schafft, Zwischentöne des Ungefähren zu finden. "Der Fahrer drosselte die Geschwindigkeit, und während sie mit einem leisen Tuckern an den anderen Booten vorbeizogen, sah Waclaw all die Fliegen, Motten und Falter, die als weiße Schatten um die Scheinwerfer im Hafen tanzten, ein durchsichtig helles Schwärmen, irritierend schön vor dem Dunkel der Nacht. Darin all das Flirrende vieler Jahre, die sich zu nichts verbanden, die ungeordnet auftauchten im begrenzenden Kegel Licht." Ob man mit einem so hohen Ton, der vor Misstönen nicht gefeit ist, der Plackerei eines Ölbohrarbeiters gerecht wird, muss hier zum Glück nicht entschieden werden.
ANDREA DIENER
Anja Kampmann: "Wie hoch die Wasser steigen". Roman.
Hanser Verlag, München 2018. 352 S., geb., 23,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH