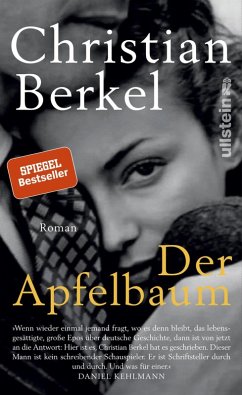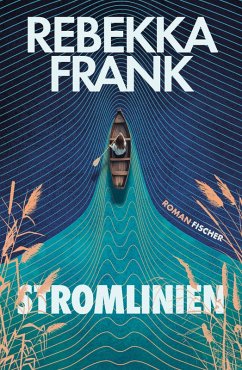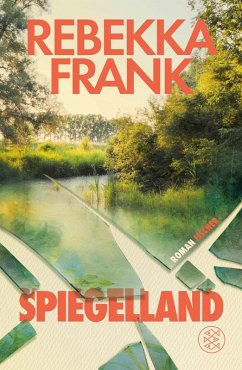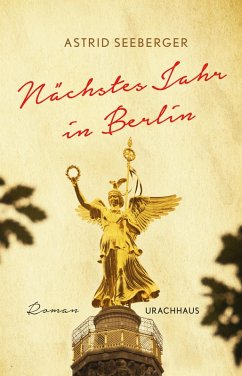Wie kommt der Krieg ins Kind (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
17,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2018Ein sehr persönliches Buch über das Schicksal der Mutter und der eigenen Familie. Spurensuche, deutsch-polnische Geschichtsschreibung und Erzählung in einem. Vierzehn Jahre alt ist die Mutter, als sie 1945 verhaftet und für Jahre ins polnische Arbeitslager Potulice gebracht wird. Der Grund: Sie hatte mit neun ein Formular unterschrieben, das sie in einem von Hitler überfallenen Gebiet als Deutsche auswies. Susanne Fritz erzählt ergreifend und ohne jede vorschnelle Schuldzuweisung von dem Schicksal ihrer Mutter und der ganzen Familie über mehrer...
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2018
Ein sehr persönliches Buch über das Schicksal der Mutter und der eigenen Familie. Spurensuche, deutsch-polnische Geschichtsschreibung und Erzählung in einem. Vierzehn Jahre alt ist die Mutter, als sie 1945 verhaftet und für Jahre ins polnische Arbeitslager Potulice gebracht wird. Der Grund: Sie hatte mit neun ein Formular unterschrieben, das sie in einem von Hitler überfallenen Gebiet als Deutsche auswies. Susanne Fritz erzählt ergreifend und ohne jede vorschnelle Schuldzuweisung von dem Schicksal ihrer Mutter und der ganzen Familie über mehrere Generationen. Sie fragt nach Menschlichkeit und Verrat, nach Identität und Sprache und zieht immer wieder historische Dokumente zu Rate. So leuchtet sie nicht nur die eigene Familiengeschichte aus, sondern das deutsch-polnische Verhältnis über zwei Weltkriege hinweg mit all den historischen Umwälzungen und ihren Auswirkungen auf jeden Einzelnen. Susanne Fritz führt ein tief lotendes Gespräch mit der Vergangenheit, sie tut es, weil sie die verborgenen Auswirkungen auf ihr eigenes Dasein verstehen will.
Ein sehr persönliches Buch über das Schicksal der Mutter und der eigenen Familie. Spurensuche, deutsch-polnische Geschichtsschreibung und Erzählung in einem. Vierzehn Jahre alt ist die Mutter, als sie 1945 verhaftet und für Jahre ins polnische Arbeitslager Potulice gebracht wird. Der Grund: Sie hatte mit neun ein Formular unterschrieben, das sie in einem von Hitler überfallenen Gebiet als Deutsche auswies. Susanne Fritz erzählt ergreifend und ohne jede vorschnelle Schuldzuweisung von dem Schicksal ihrer Mutter und der ganzen Familie über mehrere Generationen. Sie fragt nach Menschlichkeit und Verrat, nach Identität und Sprache und zieht immer wieder historische Dokumente zu Rate. So leuchtet sie nicht nur die eigene Familiengeschichte aus, sondern das deutsch-polnische Verhältnis über zwei Weltkriege hinweg mit all den historischen Umwälzungen und ihren Auswirkungen auf jeden Einzelnen. Susanne Fritz führt ein tief lotendes Gespräch mit der Vergangenheit, sie tut es, weil sie die verborgenen Auswirkungen auf ihr eigenes Dasein verstehen will.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.