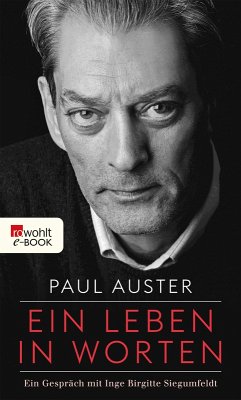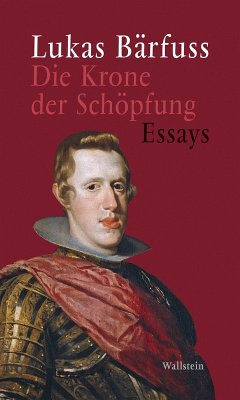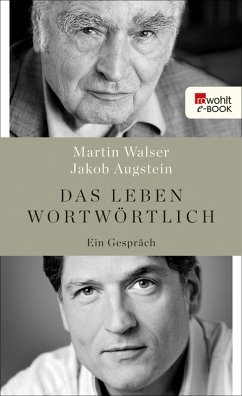»Wie Sie mir auf den Leib rücken!« (eBook, ePUB)
Interviews und Gespräche
Redaktion: Strässle, Thomas
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Schriftsteller sind beliebte Interviewpartner, aus zweierlei Gründen: Man erhofft sich von ihnen Aufschluss über ihre eigenen Werke und Aufklärung über die allgemeine Weltlage. Das Schriftstellerinterview ist eine Fortsetzung der Literatur mit den Mitteln der Mediensprache. Es lebt von der Unmittelbarkeit, mit der sich Schriftsteller zu Wort melden und zu literarischen, gesellschaftlichen und politischen Themen Stellung beziehen.Max Frisch war der Inbegriff eines Schriftstellers, der sich einmischt und gehört wird. Er hat unzählige Interviews gegeben, obwohl er sie eigentlich gar nicht m...
Schriftsteller sind beliebte Interviewpartner, aus zweierlei Gründen: Man erhofft sich von ihnen Aufschluss über ihre eigenen Werke und Aufklärung über die allgemeine Weltlage. Das Schriftstellerinterview ist eine Fortsetzung der Literatur mit den Mitteln der Mediensprache. Es lebt von der Unmittelbarkeit, mit der sich Schriftsteller zu Wort melden und zu literarischen, gesellschaftlichen und politischen Themen Stellung beziehen.
Max Frisch war der Inbegriff eines Schriftstellers, der sich einmischt und gehört wird. Er hat unzählige Interviews gegeben, obwohl er sie eigentlich gar nicht mochte. Umso virtuoser beherrschte er sie: Er war ein master conversationalist, wie sich Jodi Daynard ausdrückt, die ihn in den achtziger Jahren drei Tage lang interviewte.
Nun erscheint erstmals eine Auswahl der besten Interviews und Gespräche mit Max Frisch. Einige davon werden zum ersten Mal überhaupt oder zum ersten Mal in voller Länge oder zum ersten Mal in deutscher Sprache veröffentlicht. Im Gespräch über Themen wie Vernunft und Utopie, Ideologie und Kritik, Hass und Gewalt, aber auch über Fakt und Fiktion, Poesie und Polemik werden Fragen beantwortet, die bis heute aktuell sind.
Max Frisch war der Inbegriff eines Schriftstellers, der sich einmischt und gehört wird. Er hat unzählige Interviews gegeben, obwohl er sie eigentlich gar nicht mochte. Umso virtuoser beherrschte er sie: Er war ein master conversationalist, wie sich Jodi Daynard ausdrückt, die ihn in den achtziger Jahren drei Tage lang interviewte.
Nun erscheint erstmals eine Auswahl der besten Interviews und Gespräche mit Max Frisch. Einige davon werden zum ersten Mal überhaupt oder zum ersten Mal in voller Länge oder zum ersten Mal in deutscher Sprache veröffentlicht. Im Gespräch über Themen wie Vernunft und Utopie, Ideologie und Kritik, Hass und Gewalt, aber auch über Fakt und Fiktion, Poesie und Polemik werden Fragen beantwortet, die bis heute aktuell sind.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.




andrejr.jpg)