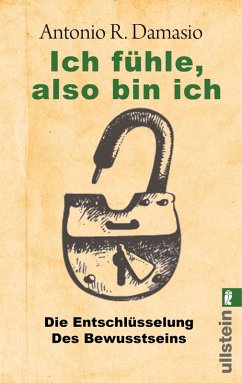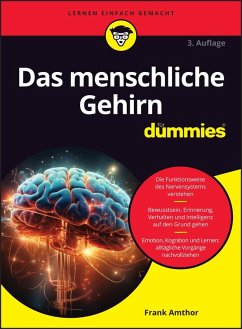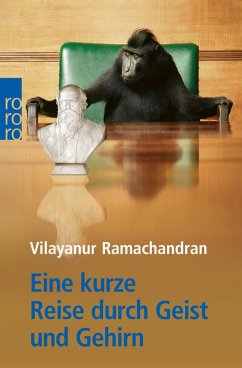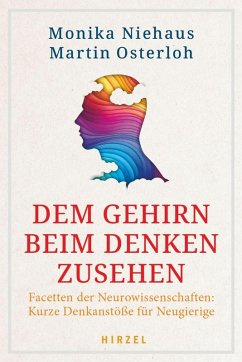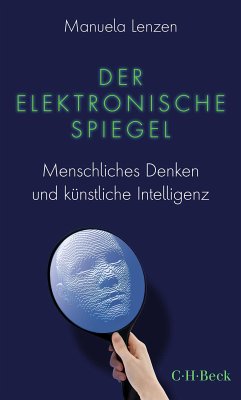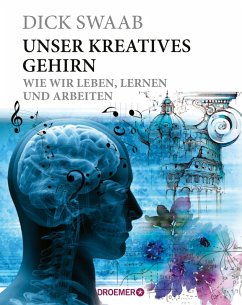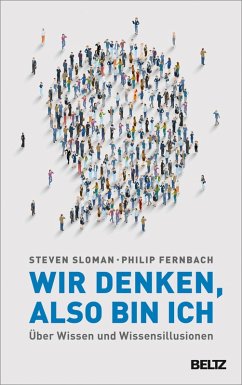Wie wir denken, wie wir fühlen (eBook, ePUB)
Die Ursprünge unseres Bewusstseins
Übersetzer: Vogel, Sebastian
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
8,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was macht uns zum Menschen? Antonio Damasio schafft die Verbindung von Philosophie und Hirnforschung zu einer erstaunlichen Theorie des Bewusstseins "Wie wir denken, wie wir fühlen" bringt Antonio Damasios Lebensthemen auf den Punkt: In glänzend geschriebenen kurzen Kapiteln führt er uns vom Beginn des Lebens auf der Erde hin zu einem umfassenden Verständnis dessen, was uns im Innersten ausmacht - Verstand, aber auch: Emotion. Was ist Bewusstsein? Kaum eine Frage rührt so sehr an den Kern des Menschseins. Seit Jahrhunderten wird sie von Philosophen gestellt, seit Neuerem bemühen sich auc...
Was macht uns zum Menschen? Antonio Damasio schafft die Verbindung von Philosophie und Hirnforschung zu einer erstaunlichen Theorie des Bewusstseins "Wie wir denken, wie wir fühlen" bringt Antonio Damasios Lebensthemen auf den Punkt: In glänzend geschriebenen kurzen Kapiteln führt er uns vom Beginn des Lebens auf der Erde hin zu einem umfassenden Verständnis dessen, was uns im Innersten ausmacht - Verstand, aber auch: Emotion. Was ist Bewusstsein? Kaum eine Frage rührt so sehr an den Kern des Menschseins. Seit Jahrhunderten wird sie von Philosophen gestellt, seit Neuerem bemühen sich auch die Naturwissenschaften um Antworten. Antonio Damasio, gefeierter Sachbuchautor und einer der renommiertesten Neurowissenschaftler der Welt, verbindet Erkenntnisse aus Philosophie und Hirnforschung, aus Evolutions- und Neurobiologie, aus Psychologie und KI-Forschung zu einer originellen Theorie des Bewusstseins.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.