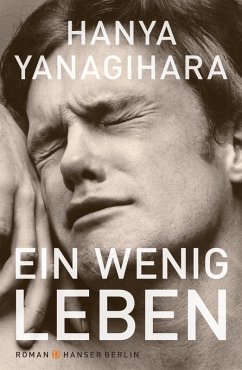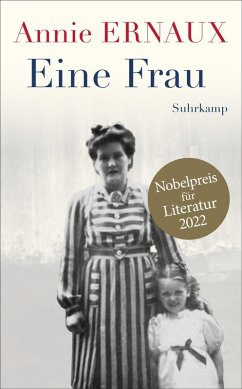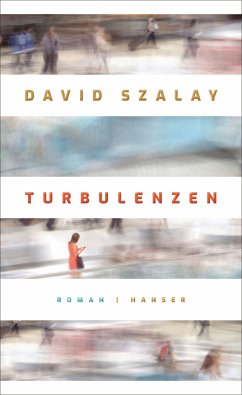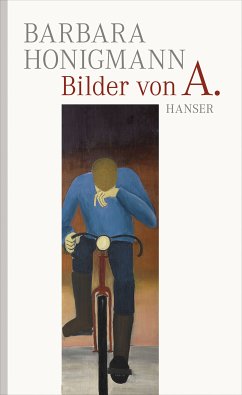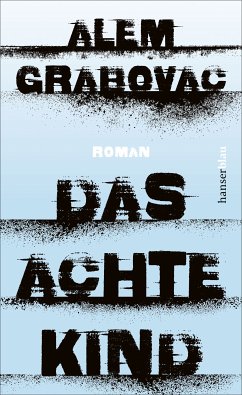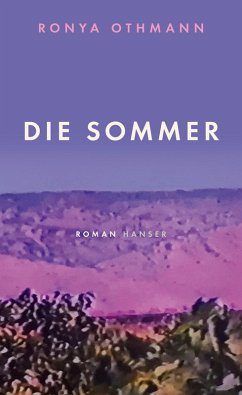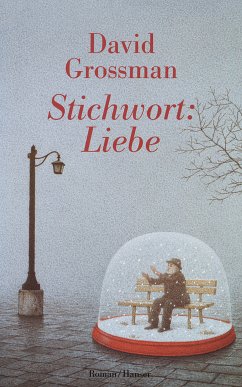Wie wir jetzt leben (eBook, ePUB)
Erzählungen
Übersetzer: Razum, Kathrin
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
12,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Ihre Prosa gibt ein schmerzhaftes Gefühl von Ungewissheit preis.« (New Yorker) - Susan Sontags wichtigste Erzählungen endlich auf Deutsch Es sind Lebensthemen, die Susan Sontag in ihren Erzählungen bewegen: Mit 14 besucht sie Thomas Mann in seinem kalifornischen Exil - mit hinreißender Ironie beschreibt sie die Verletzlichkeit ihres jugendlichen Ichs. Jahre später erfährt Sontag von der AIDS-Diagnose eines engen Freundes - ihre Ängste und Hoffnungen werden zum Stimmenchor des intellektuellen New York. Und lange nach ihren berühmten Essays über Fotografie beschäftigt sie sich wiede...
»Ihre Prosa gibt ein schmerzhaftes Gefühl von Ungewissheit preis.« (New Yorker) - Susan Sontags wichtigste Erzählungen endlich auf Deutsch Es sind Lebensthemen, die Susan Sontag in ihren Erzählungen bewegen: Mit 14 besucht sie Thomas Mann in seinem kalifornischen Exil - mit hinreißender Ironie beschreibt sie die Verletzlichkeit ihres jugendlichen Ichs. Jahre später erfährt Sontag von der AIDS-Diagnose eines engen Freundes - ihre Ängste und Hoffnungen werden zum Stimmenchor des intellektuellen New York. Und lange nach ihren berühmten Essays über Fotografie beschäftigt sie sich wieder mit dem Verhältnis von Bildern und Realität - in der Geschichte von einem Vogel und einem Nachkommen Noahs. Dieser Band versammelt wichtige Erzählungen der großen amerikanischen Autorin endlich auf Deutsch - sie zeigen sie von ihrer persönlichsten Seite.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.