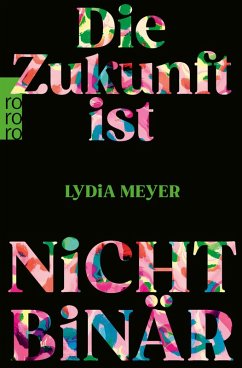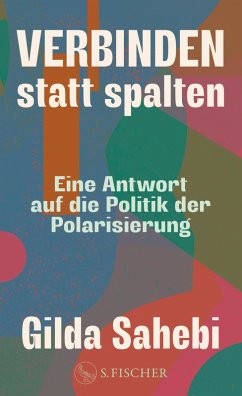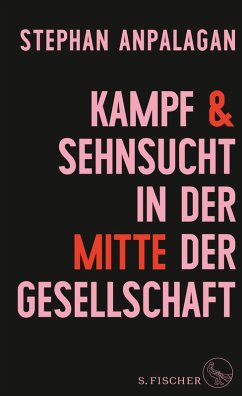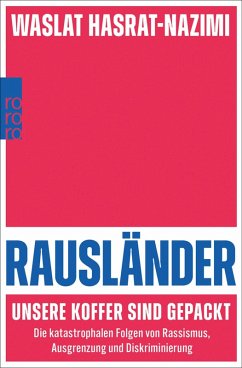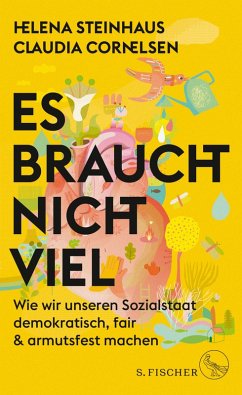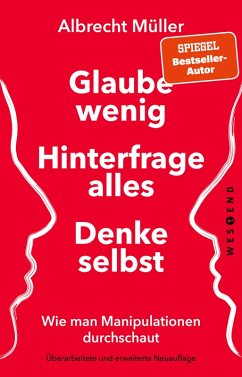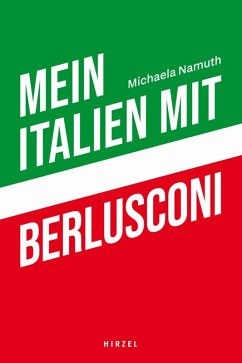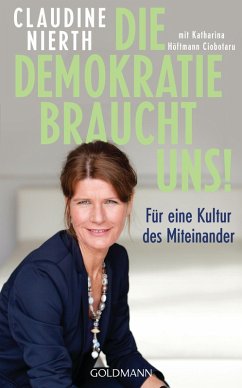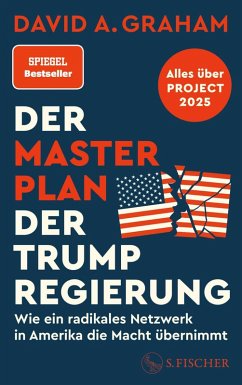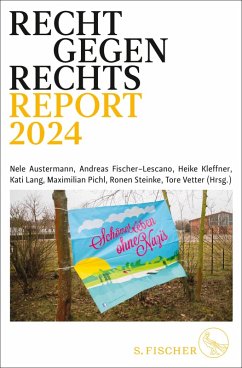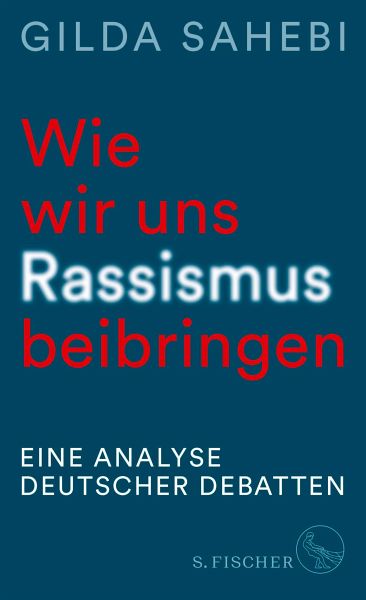
Wie wir uns Rassismus beibringen (eBook, ePUB)
Eine Analyse deutscher Debatten
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Eine längst überfällige Betrachtung rassistischen Denkens in Deutschland Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi zeigt in ihrer klaren Analyse: Wir alle denken rassistisch. Mit Extremismus hat das nichts zu tun. Sondern es ist Konsequenz politischer und gesellschaftlicher Strukturen, die unser Denken und unser Handeln formen. Wo Mehrheits- und Minderheitsgesellschaften aufeinandertreffen, bilden sich fast zwangsläufig rassistische Denkmuster und Strukturen - außer man steuert bewusst dagegen. In Deutschland tut man das nicht. Der Rassismus-»Vorwurf«: Er wird abgetan. ...
Eine längst überfällige Betrachtung rassistischen Denkens in Deutschland Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi zeigt in ihrer klaren Analyse: Wir alle denken rassistisch. Mit Extremismus hat das nichts zu tun. Sondern es ist Konsequenz politischer und gesellschaftlicher Strukturen, die unser Denken und unser Handeln formen. Wo Mehrheits- und Minderheitsgesellschaften aufeinandertreffen, bilden sich fast zwangsläufig rassistische Denkmuster und Strukturen - außer man steuert bewusst dagegen. In Deutschland tut man das nicht. Der Rassismus-»Vorwurf«: Er wird abgetan. Lieber empört man sich, als eine ernsthafte Debatte zu führen und tatsächliche Probleme zu lösen. Gilda Sahebi analysiert die Spezifika des deutschen Rassismus. Dafür blickt sie zurück bis ins Deutsche Kaiserreich und verfolgt die roten Fäden rassistischen Denkens, die sich von damals bis in die Debatten unserer Gegenwart - etwa um die Staatsbürgerschaft, den Nahostkonflikt oder Migration - ziehen. Sie zeigt, wie wir rassistische und spaltende Narrative stetig weitertragen, uns Rassismus immer wieder beibringen - und damit die Demokratie gefährden.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.