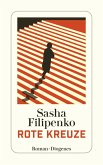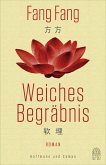Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Der wohl französischste Autor der jüngeren deutschen Literatur: Mirko Bonné heftet sich an die Stoßstange von Albert Camus und erzählt in seinem neuen Roman von zwei Unfällen in der französischen Provinz.
Wie heiter die Fahrt in halsbrecherischem Tempo", schreibt Albert Camus in einem Gedicht, das Mirko Bonné (selber einst leidenschaftlicher Alfa-Romeo-Fahrer) seinem neuen Roman voranstellt. "Wahrheit lügt, Offenheit verhehlt. Verbirg dich im Licht." Das Absurde kann "jeden beliebigen Menschen an jeder beliebigen Straßenecke anspringen", vor allem, wenn er im Winter mit halsbrecherischen 135 Stundenkilometern auf der Landstraße unterwegs ist. Am 4. Januar 1960, mitten im heiteren Gespräch, starb Camus bei Villeblin südöstlich von Paris, als der Facel Vega - eine imposante Fehlkonstruktion mit 260 PS und berüchtigten "Selbstmördertüren" - von Michel Gallimard, dem Neffen und Kronprinzen seines Verlegers, bei überhöhter Geschwindigkeit von der Route Nationale 6 abkam. Camus hat den Verkehrsunfall einmal den absurdesten aller Tode genannt. Der Autor von "Der glückliche Tod" war sofort tot; Gallimard starb wenige Tage später, seine Frau und seine Tochter überlebten.
Am selben Tag geschah in Villeblin noch ein anderer Unfall, der Bonnés Erzähler alles raubte, woran er geglaubt hatte: seine große Liebe, seinen besten Freund, die Hoffnung auf eine bessere Welt anderswo. Zusammen mit Maurice hatte Raymond eine Draisine zur "Großen Maschine des Verschwindens" umgebaut, auf der sie aus ihrem Provinzkaff fliehen wollten; aber als es dann so weit war, ließen Maurice und Delphine ihn im Stich. Der pubertäre Traum vom großen Verschwinden endete an einer Weiche, die sich nicht umlegen ließ: Raymonds Jugend ging an diesem verhängnisvollen Tag zu Ende, und mit seiner Unschuld zerbrach auch das Vertrauen in die Menschen.
Vier Jahrzehnte später bittet Maurice, inzwischen Schriftsteller im letzten Stadium einer unheilbaren Lateralsklerose, in Briefen um Verzeihung, aber Raymond, nach einer schweren Herzerkrankung frühpensioniert und seit dem Tod seiner Frau vollends apathisch und depressiv, weist das Ansinnen mit der Kälte des gelernten Wissenschaftlers ab. "Wen kümmert schon die Seelenpein eines anderen. Eine Fehlfunktion von Gehirn und Neurotransmittern. Wen kümmert die meine? Einen, so schien es, der im Sterben lag, den ich seit 38 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Aber hatte mich deshalb auch gleich seine Seelenfehlfunktion zu kümmern?"
Camus, ihr gemeinsames Idol (der von seinem Kampfgefährten Sartre auf ähnlich schmerzhafte Weise entzweit wurde), forderte menschliche Solidarität im Angesicht des Todes, Überwindung der Tragik durch Pflichterfüllung, die Revolte eines "höhnischen Trotzdem". Aber die Briefe nähren in Raymond den schrecklichen Verdacht, dass Maurice ihm auch Veronique, Stütze und Trost seines zweiten Lebens, gestohlen haben könnte, und diese Kränkung wiegt noch schwerer als der erste Verrat.
Das bisschen Lebensfreude, das ihm noch geblieben ist, wird von den Sorgen um seine Töchter aufgezehrt. Jeanne hat gerade ihre Ehe mit André für eine Affäre mit einem dahergelaufenen Schläger weggeworfen. Raymond gerät zwischen die Fronten des Ehekriegs; Pénélope, seine jüngere Tochter, ist zu weit weg und zu ungestüm, um ihrem hilflosen Vater beistehen zu können. So fühlt sich der lebensmüde Rentner "fehl am Platz in der Ordnung der Dinge", im freien Fall zum Tod: Kein Bote aus der Vergangenheit, keine zur Versöhnung ausgestreckte Hand sollen ihn aus Isolation und Verbitterung aufstören dürfen.
Bonné gelingt es immer wieder, die "vergrübelte Düsternis" in Raymonds "Kummermuseum" durch lebenskluge Gedanken und Geschichten aus dem Mikrokosmos der französischen Provinz aufzuhellen. Beiläufig und bedächtig verschränkt er das große Verschwinden Camus' mit den kleinen Fluchten seiner jugendlichen Schüler und führt die beiden unsterblich verfeindeten Jugendfreunde auf Umwegen und Nebenstraßen schließlich ohne falsche Sentimentalität wieder zusammen. Am Ende kommt die Maschine des Verschwindens, die so lange auf dem toten Gleis stand, noch einmal in Fahrt. Die in Superzeitlupe gedehnte Erzählung von Camus' letzten Sekunden, die Maurice seinen Briefen beilegt, lösen Hemmschuhe und Bremsklötze in Raymond; seine neue Freundin Robertine setzt ihn behutsam aufs richtige Gleis. Widerstrebend und misstrauisch, beginnt er seinen alten Groll zu überwinden.
Als er ihm in Auvers-sur-Oise (wo auch van Gogh begraben liegt) schließlich gegenübertritt, kann Maurice nicht einmal mehr sprechen: Das Zucken der Lidmuskeln ist das Morsealphabet des gelähmten Autors, das nur noch ein Liebender nachbuchstabieren kann. Delphines Sohn liest seinem Stiefvater mit einer Wunderbrille von den Augen ab, was noch zu sagen ist. Es ist nicht mehr viel, aber genug, um, ganz im Sinne Camus', das Kriegsbeil zu begraben: Das Leben mag sinnlos sein, aber man darf es nicht wegwerfen. Die Leere hält niemand alleine aus; man tut gut daran, "seine stärkste Wache am Tor zum Nichts aufzustellen" und auf den Beistand von Freunden nicht zu verzichten. So gelingt das Wiedersehen, das sich Raymond nur als Zusammenstoß zweier Züge vorstellen konnte, wider Erwarten doch: als erinnernde, verzeihende Vergegenwärtigung geteilten Leids und gemeinsam erfahrener Absurdität. "Der Tod setzt allem eine Grenze, nicht aber dem Erzählen."
Mirko Bonnés Gedichte und Romane sind schon viel gelobt worden, aber er wird immer noch nicht gebührend geschätzt. In "Wie wir verschwinden" erzählt er so ruhig und gelassen von der Kunst des Lebens und Sterbens, vom Umgang mit Trauer und Schuld, dass das ernste Thema alles tragische Pathos verliert. Sein Roman ist nicht frei von Längen und altersweiser Behäbigkeit, aber auch voll französischer Leichtigkeit und Esprit. Der melancholische Zauber der Provinz im Dreieck zwischen Villeblin, Versailles und Auvers erinnert an Françoise Sagans "Bonjour Tristesse", die prekäre Dreiecksbeziehung an Truffaut-Filme, das Plaudern in lauen Sommernächten an Eric Rohmer. Raymond, der schwermütige stille Brüter, ist eine durchaus deutsche Figur. Aber wie die beiden Jungexistentialisten durch den Tod ihres Idols getrennt und wieder zusammengeführt werden, auf der Suche nach der verlorenen Zeit traurige Chansons im Autoradio hören und geistreich-elegant Aristoteles, Lully, Nabokov, Einstein und andere Bildungshelden beschwören: Das macht Bonné zum wohl französischsten Autor in der neueren deutschen Literatur.
Raymond hat den "Mythos des Sisyphos" nie gelesen, aber am Ende muss man sich ihn als glücklichen Menschen vorstellen. Der leidgeprüfte, mit seinem Schicksal hadernde Frührentner hat den Stein, unter dem seine Jugendträume begraben liegen, so beharrlich um und um gewendet, bis er zuletzt doch noch ins Rollen kam. Leben war für Camus Bewegung, Neugier, Offenheit und reine kinetische Energie, Tod dagegen Stillstand und Unbeweglichkeit. Im selben Maße, wie Maurice bewegungslos verdämmert, kehrt sein verlorener Zwillingsbruder bewegt aus der Totenstarre der Resignation ins Leben zurück. Das Unglück des einen ist das Glück des anderen; aber spätestens im Tod werden die getrennten Hälften eines absurden Schicksals wieder eins.
MARTIN HALTER
Mirko Bonné: "Wie wir verschwinden". Roman. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2009. 339 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH