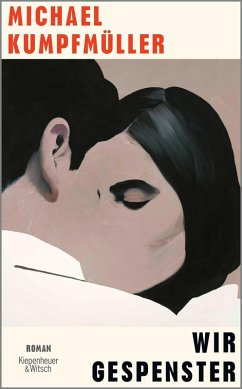Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

In Michael Kumpfmüllers Roman "Wir Gespenster" ermittelt ein Kommissar von jenseits des Grabes
Was wissen die Toten von den Lebenden? Können sie die Welt, die sie verlassen haben, irgendwie beeinflussen? Und womit beschäftigen sie sich wohl im Jenseits?
Die Antworten der Literatur auf diese Fragen fallen seit jeher höchst unterschiedlich aus, abhängig davon, wie eng die jeweiligen Autoren die beiden Welten miteinander verbunden sehen. In den klassischen Gespenstergeschichten ist die Grenze naturgemäß durchlässig, sonst würde man die Geister nicht wahrnehmen, während bei umgekehrter Perspektive gern von verzweifelten Toten erzählt wird, die - wie der ermordete Jugendliche in David Blums Roman "Kollektorgang" - den Lebenden etwas mitteilen möchten, erfolglos jedoch, weil die Hinterbliebenen sie nicht sehen oder hören. Diese Aufregung, dieser Drang, in der zurückgelassenen Welt noch irgendetwas zu ordnen, verliert sich, je länger man tot ist, die Welten rücken für die meisten Gestorbenen auseinander.
Zumal, auch darin sind sich viele der Autoren einig, die Jenseitsvorstellungen entwickeln, die Toten keine physische Existenz mehr haben, um in die Welt der Lebenden einzuwirken. In Sartres höchst einflussreichem Drehbuch "Das Spiel ist aus" verlieben sich zwei frisch Gestorbene, die in einer Gartenwirtschaft miteinander tanzen, um dann enttäuscht festzustellen, dass sie sich, so nah sie sich dabei einander fühlen, gar nicht berühren. Wie viele andere Totenwelten ist auch Sartres von dem Blick auf die der Lebenden bestimmt, von der Trauer über Versäumtes und der Erkenntnis des Scheiterns. "Man stirbt immer zu früh oder zu spät", schreibt Sartre. Und irgendwann ist das egal.
Den Texten dieser speziellen literarischen Richtung verdankt Michael Kumpfmüllers neuer Roman "Wir Gespenster" viel, auch wenn er eigene Akzente setzt. Der Roman beginnt, nachdem eine junge Frau im Park ermordet worden ist und ihr Geist nun neben ihrer Leiche steht. Dass sie Lilli heißt, hat sie vergessen, ihre Lebensumstände auch. Erst die Bekanntschaft mit dem ebenfalls verstorbenen Kommissar Andrä, der sich behutsam, aber auch beharrlich um sie kümmert, verhilft ihr langsam zur lückenhaften Kenntnis ihrer einstigen Existenz: Sie lebte als kinderlose Frau eines Arztes in einem durchdesignten Haus und unterhielt eine Art Seelenfreundschaft mit einem anderen Mann.
Beide, der Ehemann und der Freund, interessieren sie nach ihrem Tod nicht mehr, nur manchmal wehen sie die Ahnungen der einstigen Gefühle an, so wie sich überhaupt die Rekonstruktion ihres Lebens als äußerst ungleichmäßig erweist. Die Existenz nach dem Tod jedenfalls ist in diesem Buch dynamisch, Erinnerungen kehren zurück und verlieren sich auch wieder, es gibt Selbsthilfegruppen der Toten, um mit dem jähen Wechsel klarzukommen, und der Kommissar mischt sich mit seinen Helfern insofern in die Welt der Lebenden ein, weil er den Mord an Lilli aufklären möchte.
Auch das Verhältnis, das diese Toten zur physischen Welt einnehmen, ist von Brüchen bestimmt: Sie sind meist unsichtbar und nicht zu hören, aber sie nehmen etwa in der Bahn Plätze ein, die sie räumen müssen, wenn Lebende sie beanspruchen. Sie spüren das Wetter offenbar nicht, bewegen sich aber laufend durch die Stadt oder benutzen Busse, und um in Wohnungen zu gelangen, sind sie auf offene Türen angewiesen, statt wie herkömmliche Gespenster durch Wände zu gehen. Lilli und Andrä gehen schließlich eine Liebesbeziehung ein, die sogar Aspekte des Körperlichen umfasst.
Bei so viel Leben im Tod gibt es dort auch Vergänglichkeit. Zehn, maximal dreißig Jahre verbringt man postum in diesem Zustand, schätzt eine Figur, dann verschwinde man - wohin, weiß niemand. "Unser zweites Leben dauert nicht ewig, also genieße es und lass die Vergangenheit Vergangenheit sein", sagt eine andere, und einige scheinen sich mit dem Gedanken der Endlichkeit sehr anzufreunden.
Zugleich kursieren unter den Toten Hinweise, wie man die umgekehrte Richtung einschlägt, wie man also versucht, gegen alle Wahrscheinlichkeit Kontakt mit den Hinterbliebenen aufzunehmen. Die seien dafür im tiefsten Unglück am empfänglichsten, oder "morgens, wenn sie dabei sind, wach zu werden; wenn sie krank sind; kurz bevor sie einschlafen und beinahe schon träumen, wenn sie Sex hatten."
Das Jenseits, das Kumpfmüller in seinem ruhig und mit Anflügen von Komik erzählten Roman entwirft, kennt keine allgemeingültigen Regeln, alles ist im Fluss, und das Liebespaar im Zentrum der Geschichte muss darin seinen Weg finden. Immerhin suchen sie ihn gemeinsam, auch wenn sich abzeichnet, dass die Gemeinsamkeit enden wird.
Dadurch rückt der Roman die beiden Welten nicht wieder dichter aneinander. Sein Blick geht auch nicht wie in Sartres Drehbuch vom Jenseits ins Diesseits. Aber die Welt der Toten wirft dadurch für ihre Bewohner Fragen auf, die denen gleichen, die sich die Lebenden stellen. Wie viel Zeit noch bleibt, ist eine, was damit anfangen, die nächste, selbst hier. Dafür hätte man nicht unbedingt sterben müssen. TILMAN SPRECKELSEN
Michael Kumpfmüller: "Wir Gespenster". Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024.
256 S., geb.,
24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.