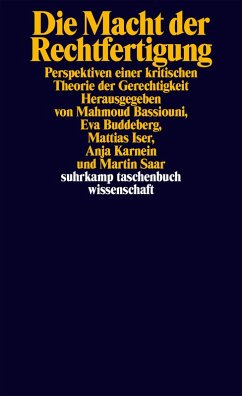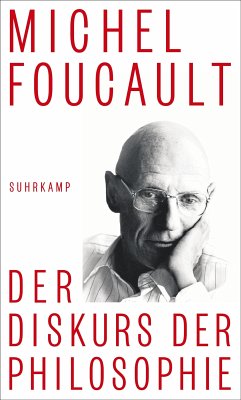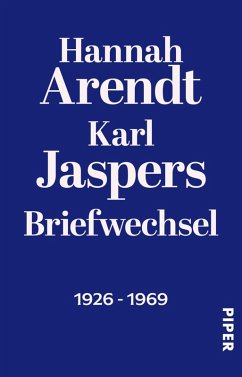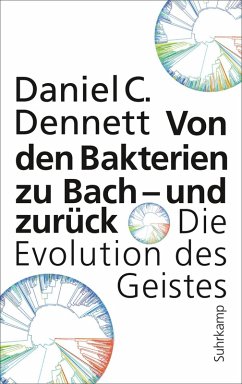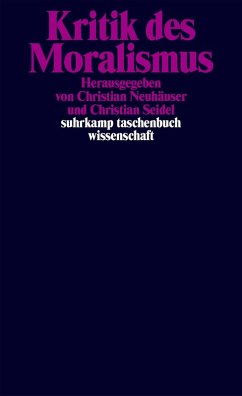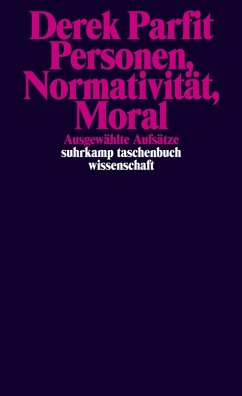Wissenschaftsfreiheit und Moral (eBook, ePUB)
Beste philosophische Aufklärung zum Streitthema »Cancel Culture«
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 30,00 €**
25,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Wissenschaftsfreiheit gilt vielerorts als bedroht von Moralismus, Denkverboten und Cancel Culture. Aber ist moralische Empörung angesichts bestimmter wissenschaftlicher Positionen - etwa zu Genetik und IQ, zu Geschlecht und Biologie oder zu Behinderung und Infantizid - immer ein ideologischer, sachfremder Versuch der Bevormundung? Oder gibt es legitime moralische Kritik an wissenschaftlichen Thesen? Der Philosoph Tim Henning geht diesen Fragen in seinem hochaktuellen und originellen Buch auf den Grund.Einerseits verteidigt er eine strenge Auffassung von Wissenschaftsfreiheit: Die Wissensc...
Die Wissenschaftsfreiheit gilt vielerorts als bedroht von Moralismus, Denkverboten und Cancel Culture. Aber ist moralische Empörung angesichts bestimmter wissenschaftlicher Positionen - etwa zu Genetik und IQ, zu Geschlecht und Biologie oder zu Behinderung und Infantizid - immer ein ideologischer, sachfremder Versuch der Bevormundung? Oder gibt es legitime moralische Kritik an wissenschaftlichen Thesen? Der Philosoph Tim Henning geht diesen Fragen in seinem hochaktuellen und originellen Buch auf den Grund.
Einerseits verteidigt er eine strenge Auffassung von Wissenschaftsfreiheit: Die Wissenschaft ist ein autonomer Bereich und sollte als solcher auch respektiert werden. Sie sollte sich allein an den Kriterien orientieren, die sich aus der immanenten Natur einer systematischen Wahrheitssuche ergeben - an Daten und Belegen, an wahr oder falsch. Andererseits betont er die Möglichkeit einer nichtmoralistischen moralischen Kritik. Ansatzpunkte hierfür finden sich im Inneren des vermeintlich reinen Bereichs wissenschaftlicher Kriterien, wie neuere Analysen aus Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie zeigen. Es sind die praktischen Kosten eines Irrtums, die sich als erkenntnistheoretisch und als moralisch relevant erweisen. Ob eine These wissenschaftlich haltbar ist, kann daher durchaus eine moralische Frage sein.
Einerseits verteidigt er eine strenge Auffassung von Wissenschaftsfreiheit: Die Wissenschaft ist ein autonomer Bereich und sollte als solcher auch respektiert werden. Sie sollte sich allein an den Kriterien orientieren, die sich aus der immanenten Natur einer systematischen Wahrheitssuche ergeben - an Daten und Belegen, an wahr oder falsch. Andererseits betont er die Möglichkeit einer nichtmoralistischen moralischen Kritik. Ansatzpunkte hierfür finden sich im Inneren des vermeintlich reinen Bereichs wissenschaftlicher Kriterien, wie neuere Analysen aus Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie zeigen. Es sind die praktischen Kosten eines Irrtums, die sich als erkenntnistheoretisch und als moralisch relevant erweisen. Ob eine These wissenschaftlich haltbar ist, kann daher durchaus eine moralische Frage sein.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.