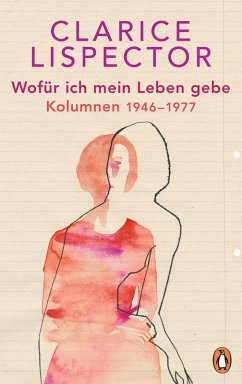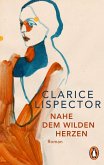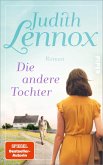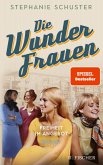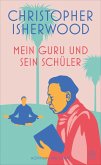Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Pressekolumnen von Clarice Lispector sind ein Spiegel des Privatlebens der Autorin und der brasilianischen Gesellschaft um sie herum
Ihre elegante Erscheinung ist an einer Bronzestatue am Strand von Copacabana zu bewundern, ihr faszinierendes Gesicht auf berühmten Porträtfotos, auf einer ungewöhnlich schönen brasilianischen Briefmarke und einem Bild von De Chirico, ihre Biographie lese sich wie ein gewaltiges Märchen, so Peter Härtling. Mit ihren eigenwilligen Romanen und Erzählungen ist Clarice Lispector eine Ikone der brasilianischen Literatur geworden, oft an der Grenze des Sag- und Verstehbaren.
Aufgrund ihrer Schönheit, ihrer Exzentrik und ihrer Aura des Geheimnisvollen wurde sie früh zur Legende, zur Sphinx von Rio de Janeiro, glühend verehrt auch nach ihrem frühen Tod 1977 mit nur 56 Jahren, vor allem in der brasilianischen Heimat, die in Wahrheit das Exil ihrer Familie war, die 1920 auf der Flucht vor russischen Pogromen im Gebiet der heutigen Ukraine floh. Traumatisch und traumatisierend dabei das Schicksal ihrer Mutter, die als Opfer einer Massenvergewaltigung mit Syphilis angesteckt worden und ohne medizinische Behandlung qualvoll zugrunde gegangen war.
Obwohl Clarice schon als Kleinkind "von dort fortgetragen wurde" und in den ärmlichen Norden Brasiliens kam, kann man in dem Mysterium ihrer Herkunft den Grund für ihr lebenslanges Fremdsein auf Erden sehen: "Clarice entstammte einem Geheimnis / und entwich in ein anderes", stellte der Dichter Carlos de Andrade zum Zeitpunkt ihres Todes fest.
"Die Romane von Clarice Lispector lassen uns häufig an die Autobiographie der heiligen Teresa denken", stand in "Le Monde", und die französische Schriftstellerin Hélène Cixous erklärte, Clarice sei die Person gewesen, zu der sich ein weiblicher Kafka entwickelt hätte oder "Rilke, wäre er eine jüdische, in der Ukraine geborene Brasilianerin gewesen. Oder Rimbaud, wäre er eine Mutter gewesen und fünfzig Jahre alt geworden."
Der amerikanische Literaturwissenschaftler Benjamin Moser hat eine einfühlsame Biographie über die geheimnisumwitterte Autorin verfasst, in der er behutsam den Legendenbildungen nachgeht, die vor allem im Vakuum ihrer eigenen Auskunftsverweigerung entstanden sind, mit vielen Zeugnissen ihrer riesigen Fangemeinde. Ihr Leben war ebenso glamourös wie rebellisch, sie studierte Jura, arbeitete als Lehrerin und Journalistin und führte zwischendurch ein eher luxuriöses Leben als Diplomatengattin. Schon ihr erster, viel beachteter Roman "Nahe dem wilden Herzen" von 1944 brach mit allen Regeln des konventionellen Schreibens.
Im deutschsprachigen Raum ist sie trotz etlicher Übersetzungen aus jüngerer Zeit immer noch zu wenig bekannt. Nun erscheint ein neuer Band, eine Auswahl der "crônicas", ihrer literarischen Chroniken der Jahre 1942 bis 1973 aus dem "Jornal do Brasil", dem führenden Presseorgan des Landes - von Luis Ruby, dessen Verehrung für diese außergewöhnliche Autorin immer wieder durchschimmert, neu aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt. Es sind keine Chroniken im üblichen Sinne, sondern etwas wie "falsche Tagebücher", nämlich Beobachtungen, Reflexionen, Erinnerungen, "am Klang entlang geschrieben", über existenzielle Themen, die Lispector in der Poesie des Alltags entdeckt. Mit eigenem Blick auf die Welt erzählte sie immer samstags, der "Rose der Woche", vom Tagesgeschehen und verwandelte persönliche Erlebnisse in Episoden, die mal heiter, mal melancholisch stimmen.
So erzählt sie von der unsterblichen Liebe eines Taxifahrers oder von der verlorenen Schönheit einer alten Freundin, die nur noch mühsam mit einem "solchen Aufwand" behauptet werden kann: "Nach kurzer Zeit war ihre mindere, oberflächliche Schönheit abgeschabt." Oder aber von den unmerklichen Rissen in der Liebe: "Wir haben das Wort Liebe nicht gebraucht, um nicht zugeben zu müssen, dass es aus Liebe und Hass geflochten ist." Oder dem Verhältnis zu ihren Söhnen: "Was ihn bedrückte, saß so tief, dass er es zu dieser Unwahrheit verformt hatte." Oder auch die Erkenntnis: "Wir haben mit Liebe unsere Gleichgültigkeit verkleidet, unsere Gleichgültigkeit mit Beklemmung, und mit der kleinen Angst die große Angst dahinter." Viele ihrer Kolumnen sind intime persönliche Bekenntnisse, meditative Selbsterforschungen, poetische Stimmungsbilder. Aber sie kann auch barsch und unleidlich sein, wenn sie den Setzer anherrscht: "Sehen Sie davon ab, mich zu verbessern. Die Interpunktion ist der Atem des Satzes, und meine Sätze atmen so."
In Passagen wie dieser erkennen wir das "monstre sacré", als das sie bei aller Verehrung auch galt. Darüber hinaus erhalten wir Einblick in das kulturelle Leben der brasilianischen Metropole jener Jahre. Die Einschränkungen des politischen Lebens unter der mehr als zwanzigjährigen Militärdiktatur lassen sich nur zwischen den Zeilen erahnen.
Mit 46 Jahren erleidet Lispector wie einige Jahre später Ingeborg Bachmann einen schweren Unfall: Einsam und tablettenabhängig setzt sie sich selbst mit einer Zigarette im Bett in Brand. Sie überlebt trotz des geschmolzenen Nachthemdes, bleibt aber versehrt, ihre Schreibhand ist nur noch ein schwarzer Klumpen. "Mit meiner verbrannten Hand schreibe ich über die Natur des Feuers", möchte man Ingeborg Bachmann zitieren. Am Ende wurde sie zu ihrer eigenen Fiktion: "Wenn ich meinem Leben einen Titel geben müsste, dann würde es lauten: Auf der Suche nach dem Ding an sich." Ihre Arbeit für den "Jornal do Brasil" endet, als sie und der jüdische Chefredakteur 1973 auf Druck arabischer Investoren entlassen werden.
Ihre crônicas haben die Unbekümmertheit und Spontaneität von Internetblogs, und ihre Fangemeinde würde man heute wohl Followers nennen. Uns geben sie in dieser sorgsam edierten Ausgabe die Möglichkeit, eine "der geheimnisvollsten Autorinnen des zwanzigsten Jahrhunderts in all ihren schillernden Facetten wiederzuentdecken", so Orhan Pamuk. Und ganz wie Marcel Proust hat auch Clarice Lispector gewusst, dass "in Wahrheit er, der Leser, der Autor ist". BARBARA VON MACHUI
Clarice Lispector: "Wofür ich mein Leben gebe". Kolumnen 1946-1977.
Aus dem brasilianischen Portugiesisch und hrsg. von Luis Ruby. Penguin, München 2023. 320 S., geb., 28,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main