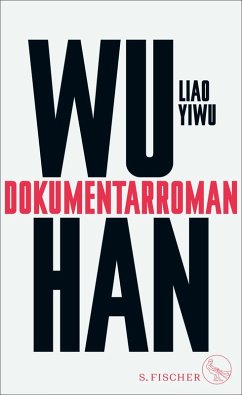Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Liao Yiwu mischt Erzählung, Dokumentation und Spekulation, um dem pandemischen Verhängnis von Wuhan auf die Spur zu kommen.
Seit mehr als zehn Jahren lebt der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu nun schon im Berliner Exil. Seine literarische Stimme ist so unverwechselbar sarkastisch, wütend, traurig, witzig und zärtlich zugleich geblieben wie in seinen großen Werken über den "Bodensatz der chinesischen Gesellschaft", die ihm unter anderem den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels eingetragen haben. In seinem jüngsten Buch, ausgewiesen als "Dokumentarroman", versucht ein Geschichtsdozent namens Ai Ding, der gerade einen Gastaufenthalt in Berlin hinter sich hat, zu Beginn der Corona-Seuche in seine Heimatstadt zurückzukehren, wo Frau und Kind auf ihn warten: Wuhan. Doch diese Stadt ist, nachdem die Behörden die Verbreitung des Virus dort zuerst vertuscht hatten, nun komplett abgeriegelt, und die Heimreise entwickelt sich zu einer wochenlangen Irrfahrt mit immer surrealeren Zügen.
Einmal sieht sich Ai Ding schon fast am Ziel, als ihn die Polizei mit einem Passierschein und einem Motorrad nebst Fahrer aus der Quarantäne entlässt. Auf dem Weg zum Bahnhof, von wo aus dann der Zug nach Wuhan fahren soll, singt der Chauffeur auf dem Motorrad, hochzufrieden mit dem Wucherpreis für die Fahrt, voll Inbrunst in seinem Heimatdialekt alte Revolutionslieder ("Bruder Aff' wird Rotarmist, Rotarmisten woll'n ihn nicht . . ."), und als kurz vor Changsha, wo der junge Mao im Fluss geschwommen haben soll, eine "in allen Farben des Regenbogens irisierende Wolke" über ihnen erscheint, gerät er ganz aus dem Häuschen: "Wahnsinn! Ein ziemlich dicker Packen 100 Yuan-Scheine da am Himmel! Es ist schon so, Vater und Mutter sind einem nicht so teuer wie der Kopf des Vorsitzenden Mao mitten drauf auf den Geldscheinen . . ." Doch von einem Moment zum anderen wird er plötzlich stocksteif, das Motorrad beginnt zu schlingern, der mitfahrende Geschichtsdozent kann es gerade noch in seine Gewalt bringen. Der Chauffeur aber röchelt nur noch, und ein paar Sekunden später ist er tot. So lässt das Virus eine burleske, mit geschichtlichen Assoziationen gespickte Alltagsszene, wie nur Liao Yiwu sie schildern kann, unvermittelt ins Absurde abkippen: Die brutal illusionslose Perspektive von unten, in der maoistische Folklore mit dem nur allzu kapitalistischen Überlebenskampf der real existierenden chinesischen Proletarier vermengt ist, erfährt durch die Epidemie eine weitere Zuspitzung.
Doch Liao bleibt in seinem neuen Buch nicht bei dieser fiktiven Handlung, er bettet sie vielmehr in ein Kaleidoskop aus Internetfundstücken, Nachrichten, Mutmaßungen und Polemiken rund um die erste Phase der Seuche ein. Das Bindeglied stellen vor allem die Videotelefonate zwischen dem Protagonisten Ai Ding und seinem Freund in Berlin, dem Schriftsteller Zhuang Zigui, her, in dem man nicht nur seines "Glatzkopfs" wegen Züge des Autors selbst erkennen kann. Zhuang ist ein eifriger Rechercheur im Internet, und so sind seine Funde die ständigen Gegenstände ihrer Gespräche. Immer wieder geht es darum, ob das Virus womöglich dem Forschungslabor P4 in Wuhan entsprungen sein könnte - deutet nicht schon die eingangs nacherzählte Episode der Verhaftung des Bürgerjournalisten Kcriss ganz in der Nähe dieses Instituts darauf hin? - oder ob es gar Teil einer "Unrestricted War"-Strategie Chinas sein könnte. Nicht, dass sich der Autor oder auch nur eine seiner Figuren solche Spekulationen zu eigen machten, immer wieder werden auch Gegenargumente genannt, doch weder der Autor noch die beiden Hauptpersonen lassen einen Zweifel daran, dass sie die Kommunistische Partei selbst schon für das Verhängnis des Landes halten.
Auch viele den sozialen Medien entnommene Szenen von verlassenen und im Elend am Virus verendenden Menschen tragen zu der zwischen Groteske und Apokalypse schwankenden Grundstimmung bei. Doch oft wirkt der Versuch, Informationen, Meinungen und Gerüchte in die Handlung zu verweben, unbeholfen. Das liegt nicht nur an der hölzernen Nachrichtensprache, die inmitten des sonst so respektlos anarchischen Tons Liaos wie ein Fremdkörper erscheint. Es liegt auch an der didaktischen Bemühtheit, mit der eine Hintergrundinformation nach der nächsten den Protagonisten in den Mund gelegt wird, etwa wenn "in einem weiteren ihrer Online-Gespräche Zhuang Zigui Ai Ding" erzählte, "dass die Staatsoberhäupter von Europa und Amerika, ganz im Sinne von Chefredakteur Hu, zunächst durchaus optimistisch und gegenüber China voll guten Willens gewesen seien". In solchen Momenten scheinen die Figuren nicht mehr aus sich heraus zu leben, sondern nur Nachrichten und Ideen zu illustrieren. Die Zwitterhaftigkeit bekommt dann auch der inhaltlichen Auseinandersetzung nicht gut. Argumentationen werden da nicht durchgehalten, sondern nur angerissen, suggeriert; als Rollenprosa heben sie sich im Zweifel gegenseitig auf.
Wo er erzählt, ist Liao Yiwu dagegen so markant wie eh und je. Schon in seinem Ton wird die Kraft dieses Autors gegenwärtig, der keinem Schmerz und keinem Schrecken ausweicht und dabei noch Sinn für Situationskomik und ein frappierendes Zartgefühl entwickelt. Einmal gibt er diese Gestalt auch direkt zu erkennen, als sein Alter Ego im Roman den verzweifelten Freund in China übers Internet mit seinem Flötenspiel tröstet und ihm Ratschläge fürs Trinken hochprozentiger Getränke gibt: "Beim Trinken geht es nicht darum, sich zu betäuben, sondern seine Gefühle auf die Reihe zu bekommen." Für seine Literatur gilt womöglich Ähnliches. MARK SIEMONS
Liao Yiwu: "Wuhan".
Dokumentarroman.
Aus dem Chinesischen
von Brigitte Höhenrieder und Hans Peter Hoffmann.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2022. 352 S.,
geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main