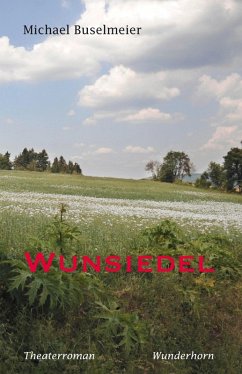Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Nicht jede schlechte Erfahrung ist für irgendetwas gut: In seinem Theaterroman "Wunsiedel" wirft Michael Buselmeier einen ungeschönten Blick zurück im Zorn.
Über Schauspieler denken viele insgeheim nichts Gutes; manche äußern es auch laut. Immer wieder einmal hört man sagen, Akteure seien abgehoben und dünkelhaft, und wenn man dann noch einen sieht, der am öffentlichen Ort, etwa im Restaurant, seinen Auftritt sucht, um laut zu rezitieren oder gar etwas zu singen - dann äußert sich bei vielen Zuschauern bald die ganze Theaterverachtung. Bei Moritz Schoppe, dem Erzähler in Michael Buselmeiers Roman "Wunsiedel", speist sie sich aus eigener Erfahrung in der Profession: Sein Theaterhass ist das Resultat einer enttäuschten Liebe.
Um die Tragödie seines Helden in Prosa darzustellen, hat Buselmeier eine interessante Konstruktion gewählt: Er lässt ihn nach vierundvierzig Jahren an den Ort der Enttäuschung zurückkehren - nach Wunsiedel im Fichtelgebirge, den Geburtsort Jean Pauls, bekannt außerdem für seine Freilichtbühne, an der alljährlich die Luisenburg-Festpiele stattfinden. Hier war der junge Moritz Schoppe im Sommer 1964 für sein erstes schauspielerisches Engagement gebucht worden; hier sucht der an Erfahrungen reiche Mann im Jahr 2008 nach den Spuren seiner Vergangenheit. Über vieles ist Gras gewachsen; die Eisenbahnschienen führen nicht einmal mehr ganz bis Wunsiedel, viele Häuser sind vernagelt. In Proustscher Manier versucht Schoppe sich den Ort von damals wieder herbeizuholen über Farben, Gerüche, "Wortbrocken im fränkischen Tonfall" - mit diesen Eindrücken als Scharnieren wechseln sich Textpassagen des Früher und Heute immer wieder ab, zeigen das zeitliche Nebeneinander im erzählerischen Bewusstsein.
Die alten Wunden indessen sind nicht verheilt: Als hoffnungsvoller Jungschauspieler tritt Schoppe in Wunsiedel an, als Dramaturg zudem, von seinem ersten Intendanten beauftragt, eine Bearbeitung von Goethes "Götz von Berlichingen" für die Spiele zu erstellen. Kurz vor Probenbeginn jedoch stirbt dieser Intendant, sein Nachfolger will von Schoppes Götz-Fassung nichts mehr wissen. Dem stillen Skeptiker, der bald ausgegrenzt und bei den Kollegen als Intellektueller verschrien ist, bleibt am Ende eine Nebenrolle mit ganzen sieben Sätzen Text. So wird ihm die Freilichtbühne zum "Verfinsterungsort".
Mit der expliziten Bezeichnung "Theaterroman" stellt sich Buselmeier bewusst in eine Tradition, die mit Goethes "Wilhelm Meister" (im Fragment seiner "theatralischen Sendung" 1777 bis 1785, zum Bildungsroman ausgearbeitet 1795) und Karl Philipp Moritz' "Anton Reiser" (1785 bis 1790) beginnt - in diesen Werken liegt die Auseinandersetzung des künstlerischen Individuums mit allen Facetten und Belangen des Theaterspielens begründet. Von der Empfindsamkeit und Verletzlichkeit des Anton Reiser hat Buselmeiers Figur vieles geerbt: Sah man Reiser gern "mit rotgeweinten Augen", so vergießt auch Schoppe manche Träne und fühlt sich "wie aus der Welt gerutscht". Andererseits kann man den Buselmeierschen Roman auch als eine moderne Variation über das ihm vorangestellte Wilhelm-Meister-Motto beschreiben, das über die Theaterleute ein vernichtendes Urteil fällt: "Wie völlig diese Menschen mit sich selbst unbekannt sind, wie sie ihr Geschäft ohne Nachdenken treiben, wie ihre Anforderungen ohne Grenzen sind, davon hat man keinen Begriff."
Auf einen Begriff gegen das falsche und oberflächliche Theater, mit dem er sich in Wunsiedel konfrontiert sieht, schießt sich der Erzähler Moritz Schoppe dann allerdings doch ein: Immer wieder bescheinigt er sämtlichen Kollegen, die er dort antrifft, und insbesondere dem Intendanten, "Geistesferne". Er sieht in ihnen "krakeelende Spießbürger, Zotenreißer, Rampenschweine und Kantinenhocker". Die Polemik, mit der er immer wieder gegen das eigene Metier zu Felde zieht, seine bisweilen auch zur Redundanz neigenden Tiraden, veranschaulichen das Ausmaß einer persönlichen Katastrophe, bei der so mancher vielleicht sagen würde: Wen schert's denn nach so vielen Jahren noch? Die Schwere dieses Traumas erklärt sich aber auch erst recht, wenn man die Kollateralschäden betrachtet: In der Zeit seiner Abwesenheit vom heimatlichen Heidelberg verliert der Erzähler seine dort lebende Freundin, die ihn betrügt und dann bei dem anderen bleibt. Und das von ihm erfahrene Heimweh fördert eine schreckliche Erinnerung zutage, die ein von der Mutter ins Heim abgeschobenes Kind verzweifeln sieht. In der Terminologie Roger Willemsens, den der Erzähler Schoppe womöglich verachtet hätte, wäre die traumatische Theaterepisode in Wunsiedel ganz einfach zu beschreiben: als "Knacks" in Schoppes Leben.
Wie aber oft auch ein Knacks den Menschen erst auf den richtigen Lebensweg führt, so dient die Abkehr vom Theater dem Erzähler hier letztlich dazu, seine Rolle als Schriftsteller zu finden: Er sieht sich, das wird im Laufe des Romans immer deutlicher, als beobachtenden Außenseiter, der jede Geselligkeit verachtet. Frieden findet er nur in Wald und Wiesen, die er im hohen und heiligen Ton von Empfindsamkeit und Romantik preist: Nicht Waldluft atmet so einer, sondern "Waldesluft". Vielleicht lässt sich Schoppes ganzes Übel auch schon damit erklären, dass er das geliebte Heidelberg verlassen muss, was noch nie einfach war, befragt man Dichter wie Eichendorff oder Scheffel. Bei Buselmeier heißt es: "Ich war todtraurig, sobald ich das Neckartal hinter mir wusste."
Die Verfinsterung wird zwar stellenweise aufgehellt durch den Trost in der Natur und im Lesen Jean Pauls, zu dem sich Schoppe nächtelang in seiner Dachkammer flüchtet. Auch zeigt sich der gealterte Erzähler gelegentlich versöhnlich mit der Bilanz seines Lebens - letztlich ist dieser Roman, trotz seiner Kürze, auch eine seelische Biographie, hierin nochmals den Bogen zu "Anton Reiser" schlagend. Es bleibt aber, und dies macht Buselmeiers Buch stark, ein ungeschöntes Eingeständnis der Bitternis und gekränkten Eitelkeit, die ein Leben überschatten kann, und bei dem eben nicht jede schlechte Erinnerung nachträglich nur daraufhin befragt wird, wofür sie gut war.
Mit dem hintergründig-ironischen Jean Paul, den er bewundert, hat der Erzähler Schoppe nichts gemein, sein Stil ist im Gegenteil immer ernst und klar. Und doch birgt auch diese Prosa ihre Geheimnisse: etwa jenes, warum denn bei der Ankunft des jungen Schoppe in Wunsiedel im Juni 1964 an den Birnen- und Apfelbäumen bereits "die Früchte blinkten wie gelbrote Lampions". Man mag dies für einen Fehler in der Fiktion halten oder an einen sehr frühvollendeten Sommer jenes Jahres glauben - es spricht aber auch etwas dafür, dass genau an solchen kleinen Fingerzeigen ein Grundzug des Buches sich offenbart, in dem auch sein künstlerischer Reiz liegt: Die Zeit, in der Schoppe jung und grün war, so wie die Früchte am Baum es eigentlich sein müssten, ist eine immer schon aus dem Rückblick geschilderte, stets durchwirkt mit der ihr ex post zugewiesenen Bedeutung. Denn als er dies alles erzählt, eben vierundvierzig Jahre später, da hat der Held die Hölderlinsche "Hälfte des Lebens" eben schon überschritten, ist weit in der Zeit der gelben Birnen.
JAN WIELE
Michael Buselmeier: "Wunsiedel". Theaterroman.
Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2011. 158 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH