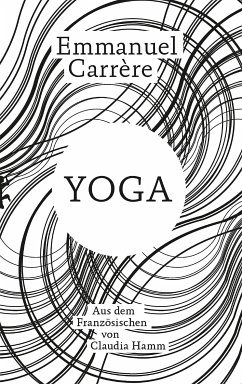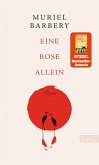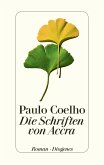Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

In Frankreich machte dieses Buch Skandal: Emmanuel Carrères Roman "Yoga" ist ein ebenso virtuoses wie umstrittenes Beispiel der Autofiktion
Die elegante Untertreibung ist Emmanuel Carrères zentrales Stilmittel. Wer "Yoga", dem Titel seines neuesten Romans, folgt und ein sanftes, spirituelles Buch erwartet, sollte durch den Vorgänger "Alles ist wahr" (2009) gewarnt sein: Dort berichtet Carrère vom Tsunami des Jahres 2004, dessen Zeuge er auf Sri Lanka wurde, und fügt ätzende Seitenhiebe auf eine Gruppe von schweizerdeutschen Ayurveda-Anhängern ein, die in Chaos und Leid ihren Übungen nachgehen, als wäre nichts geschehen. Im neuesten Roman nun bricht abermals Zerstörung ein: Das Projekt eines Yoga-Buches wird durch die physische Gewalt islamistischer Attentate und die psychische eines depressiven Zusammenbruchs sabotiert. Am Ende ist alles brüchig: Stil, Buchprojekt und Psyche.
Zum Ausgangsprojekt: Mit dem Vorhaben, das eigene Ego zu disziplinieren und "ein heiteres, feinsinniges Büchlein über Yoga" zu schreiben, geht der Icherzähler im Januar 2015 ins Morvan, um dort einen Vipassana-Kurs zu machen. Die Vorgabe: zehn Tage Isolation, Schweigen, Diät, Meditation. Er beschreibt die ersten zwei Tage und flicht ein, was Tai-Chi und Yoga für ihn bedeuten; er versucht sich an Definitionen, berichtet von Erlebnissen, etwa einer Tai-Chi-Stunde in Kanada, die ein Wolf beobachtet, oder einer heißen Sexaffäre nach einem Intensivkurs. Er schildert sich und die anderen auf der Suche nach innerem Frieden: ein Carrère-Paradestück, das, scheinbar harmlos, das Menschlich-Allzumenschliche mit ätzendem Verständnis auslotet und sich selbst einen verdienten Platz als "Berg mit Kühen-Meditierer" sichert.
Der erste Teil endet abrupt: Die "Charlie Hebdo"-Attentate zwingen den Erzähler zur Abreise, weil er die Grabrede auf seinen ermordeten Freund Bernard Maris halten muss. Die Krise mündet in einen psychischen Zusammenbruch, ohne dass Chronologie und Kausalität klar würden - eine eigenartige Lücke. Jedenfalls durchlebt er eine Depression, die zu einem viermonatigen Aufenthalt in der Psychiatrie führt. Man diagnostiziert bei ihm Tachypsychie - "etwas wie Herzrasen, nur für geistige Aktivitäten" - als Teil einer Bipolar-II-Störung; wegen der Suizidwünsche durchläuft der Erzähler eine Elektrokonvulsionstherapie. Teil vier und fünf berichten vom schweren Neuanfang: Der Erzähler hilft auf einer griechischen Insel dabei, Flüchtlingsjungen zu unterrichten. Abschließend berichtet Carrère von den letzten Kontakten mit seinem langjährigen Verleger Paul Otchakovsky-Laurens und der Niederschrift des Romans, die nach mehreren Anläufen endlich gelingt.
Nach "Das Königreich" (2014) war "Yoga" ein lang erwartetes Werk und ein Favorit auf den Prix Goncourt 2020. Da brach im September des Jahres eine Polemik los, die unter anderem die Frage aufwarf, ob "Yoga" überhaupt ein Roman ist. Als Gerüchte von Eingriffen kursierten, die Textlücken erklären würden, machte die Journalistin Hélène Devynck, von 2011 bis 2020 Carrères Ehefrau, von ihrem Recht auf Gegendarstellung Gebrauch. In "Vanity Fair" erinnerte sie an den Vertrag, der Carrère verbiete, ihr Privatleben ohne ihre Einwilligung öffentlich zu machen. "Yoga" habe diese Vereinbarung nicht respektiert und verzerre die Wirklichkeit: Wenige Tage mit Flüchtlingen seien zu zwei Monaten gedehnt und zeitlich verschoben worden (tatsächlich hätten sie vor dem Psychiatrie-Aufenthalt stattgefunden); aggressives Verhalten während der Krankheit werde heruntergespielt, die familiäre Unterstützung unterschlagen. Die Polemik kostete wohl die Goncourt-Chancen.
So what? "Yoga" ist ein Roman, könnte man einwenden. Nur behauptet Carrère etwas anderes: "Was die Literatur betrifft oder zumindest die Art von Literatur, der ich nachgehe, habe ich eine, eine einzige, Überzeugung: Sie ist der Ort, an dem man nicht lügt. Dieser Imperativ ist absolut, alles andere ist nebensächlich, und ich glaube, mich immer an diesen Imperativ gehalten zu haben." Das behauptet "Yoga" mehr als einmal: "Jemand wie ich, der keine Fiktion schreibt", sagt Carrère und lehnt die Bezeichnung Autofiktion ab. Die Kontroverse bringt zum Grübeln: Es wirkt bedenklich, dass Carrère das Wahrhaftigkeits-Credo ausgerechnet mit "Der Widersacher" (2000) entwickelt hat, einem Text über einen pathologischen Lügner und Mörder, der im Buch mit großer Empathie dargestellt wird.
Brisant ist der Sachverhalt auch deshalb, weil er einen Gutteil der zeitgenössischen Literatur mittrifft: Ob sie sich Autofiktion nennt oder nicht, Energie und Erfolg zieht sie aus dem Willen zur Wahrhaftigkeit, das gilt für Annie Ernaux, Édouard Louis oder Christine Angot. Welche Wahrheit meint Carrère? Dass es Abbildrealismus nicht sein kann, scheint offensichtlich, Details behandelt er frei. Der schönere Originaltitel von "Alles ist wahr" lautet "D'autres vies que la mienne" (Von anderen Leben als meinem): Im intimen Grenzbereich, wo das eigene Leben anderen begegnet, ist Wahrheit meist subjektiv. Wahrheit also als Aufrichtigkeit?
Am besten konzentriert man sich auf die großen literarischen Qualitäten. "Yoga" gewinnt seine Kraft aus dem Kontrast: Das ursprüngliche Buchprojekt ist so glatt und unsympathisch, wie die Schilderung des Zusammenbruchs rau und berührend ist - sei sie erfunden oder nicht. Sätze wie "Man stirbt immer noch nicht, doch das Herz ist nicht mehr dabei" erinnern an F. Scott Fitzgeralds "The Crack-Up". Die Gedanken zur Literatur werden komplex, als Carrère erkennt, dass "psychiatrische Autobiographie" und Yoga-Essay auf unheimliche Weise zusammengehören: "Dasselbe Buch, weil das Krankheitsbild, mit dem ich zu tun habe, die entsetzliche, verkorkste Parodie des großen Gesetzes der Verwandlung ist, dessen Harmonie ich vor etwa dreißig Seiten noch so aufrichtig gefeiert habe." Er entwickelt eine abgeklärte Sicht auf Yoga und dessen Schattenseiten, etwa die Geschichte des Asketen Sangamaji mit der "Empathie einer gefrorenen Kartoffel".
Entscheidend sind Überlegungen zur Wahrheit: "Alles, was wirklich ist, ist per Definition wahr, aber manche Wahrnehmungen der Wirklichkeit haben einen höheren Wahrheitsgehalt als andere, und das sind nicht die angenehmsten. Ich glaube zum Beispiel, dass der Wahrheitsgehalt bei Dostojewski höher ist als beim Dalai Lama." Der Roman ist ein Rückblick "mit einer Mischung aus Nostalgie, bitterer Ironie und im Nachhinein Fassungslosigkeit" auf den glücklichen Menschen, der Carrère einst war; heute ist Yoga ihm nur noch eine provisorische Zuflucht. Allein die Literatur hilft, Schmerz und Chaos auszuhalten, die in Carrères wohlerzogenen Sätzen wüten. NIKLAS BENDER.
Emmanuel Carrère: "Yoga". Roman.
Aus dem Französischen von Claudia Hamm. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2022. 352 S., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main