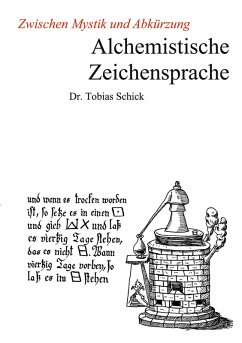Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Der Historiker Theo Jung hat eine Studie zur Selbstbeobachtung der Moderne als Epoche des Zerfalls vorgelegt
Das kulturkritische Denken sieht sich selbst in einer Krise. Diesen Befund nimmt der Freiburger Historiker Theo Jung zum Ausgangspunkt, um nach seinen Ursprüngen und seiner semantischen Formierungsgeschichte im achtzehnten Jahrhundert zu fragen. Die Suche im europäischen Meer der Texte wird dabei von der heuristischen Anfangsfestlegung geleitet, Kulturkritik sei geschichtlich orientierte Kritik an der eigenen Kultur im Ganzen.
Es sind vier Diskursfelder, die Jung genauer untersucht: die Auseinandersetzung mit der wirtschaftlichen Mobilisierung, die sich als Luxuskritik entfaltet; die Entwicklung eines Gesellschaftsbegriffs aus dem Diskurs der "Geselligkeit" heraus; die Sprachgeschichte als Medium und Thema kulturkritischen Argumentierens; schließlich die Auseinandersetzung mit dem analytisch-antitraditionalen Selbstverständnis der Aufklärer. Die Ergebnisse der zum Teil sehr verschlungenen Argumentation in den betreffenden Kapiteln sind widersprüchlich. Der Luxuskritik wird richtigerweise bescheinigt, dass sie nicht als Kulturkritik funktioniere, weil sie nicht historisch-diachron in ihren Argumenten angelegt ist, sondern binär und synchron. Sie ist ganz und gar Teil der alteuropäischen Semantik. Auch die Semantik der Geselligkeit ist offenbar nicht der Ort, an dem der holistische Gesellschaftsbegriff der Kulturkritik entsteht.
Im sprachgeschichtlichen Diskurs des achtzehnten Jahrhunderts sieht Jung hingegen einen Raum, in dem sich verzeitlichte Argumentationen der Kulturkritik entfalten und dann eine Verbindung mit dem "Volk" als einem ganzheitlichen Konzept für soziale Entitäten eingehen können. Rousseau und Herder lassen grüßen. Gegen die Kritik der Aufklärer profiliert sich das kulturkritische Denken als eines, das auf Traditionen setzt, auf Respekt vor der Ganzheit und sich deswegen hütet, sie analytisch zu zerlegen, und das sich selbst im Besitz einer wahrheitsverbürgenden Inspiration weiß, mit der man sich von standpunktverdächtiger Kritik absetzen kann.
Es gibt Passagen in diesem Buch, die man gern und mit Ertrag liest. Im Kern führt es aber nicht entscheidend über ältere Studien zur Entstehung des konservativen Denkens hinaus. Daran liegt es vielleicht auch, dass der Bezug zwischen Kulturkritik und Konservativismus nicht eingehender thematisiert wird. Man kann am Ende keine bündige Antwort auf die eingangs dringend nahegelegte Frage erkennen, warum eine Form der selbstbeobachtenden Semantik entstehen konnte, die einerseits modern ist, andererseits die Moderne negiert.
Dass man dies als Reaktion auf Rationalisierungsprozesse zu verstehen habe, haben schon andere geschrieben. Zur Beantwortung tragen auch die ausgreifenden methodischen Reflexionen zum Konzept einer "historischen Diskursanalyse" und zur "Verzeitlichung" als Grundlage der Selbstthematisierung der Moderne wenig bei. Man liest im ersten Kapitel rund siebzig Seiten dazu und viele methodologische Einsprengsel im Hauptteil, ohne ein für das Thema bedeutsames Ergebnis zu erkennen. Das dringend notwendige Lektorat ist dem Text offenbar versagt geblieben. Man hat ein schönes Buch gemacht, sich aber um den Inhalt nicht gekümmert.
RUDOLF SCHLÖGL
Theo Jung: "Zeichen des Verfalls". Semantische Studien zur Entstehung der Kulturkritik im 18. und 19. Jahrhundert.
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012. 480 S., geb., 69,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH