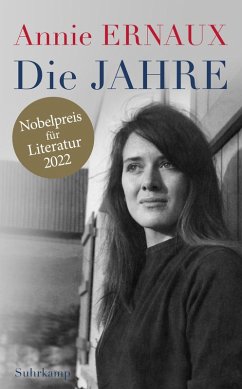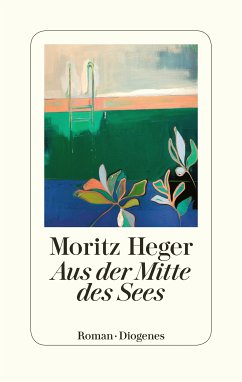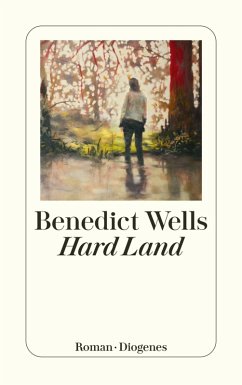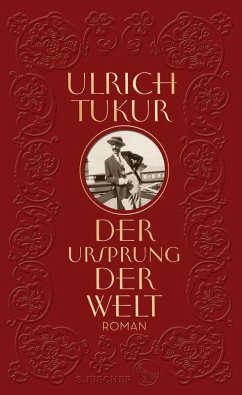Zeit der Wildschweine (eBook, ePUB)
Roman
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
15,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenken

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Reisejournalist Leon träumt von Selbstverwirklichung - für die Beständigkeit seiner Familie hat er wenig Verständnis. Als sich die Gelegenheit bietet, der Enge der Heimat zu entfliehen und stattdessen mit dem faszinierenden Fotografen Janko französische Niemandsorte zu erkunden, greift er zu. Doch auf der Reise geraten Leons Gewissheiten ins Wanken. Wie hoch ist der Preis für ein Leben ohne Verpflichtungen? Reisejournalist Leon will vieles sein: Boxer, Gitarrist, Surfer, Weltenbummler. Stattdessen ist der junge Mann vor allem ein großer Film- und Literaturliebhaber, der sein fragiles Se...
Reisejournalist Leon träumt von Selbstverwirklichung - für die Beständigkeit seiner Familie hat er wenig Verständnis. Als sich die Gelegenheit bietet, der Enge der Heimat zu entfliehen und stattdessen mit dem faszinierenden Fotografen Janko französische Niemandsorte zu erkunden, greift er zu. Doch auf der Reise geraten Leons Gewissheiten ins Wanken. Wie hoch ist der Preis für ein Leben ohne Verpflichtungen? Reisejournalist Leon will vieles sein: Boxer, Gitarrist, Surfer, Weltenbummler. Stattdessen ist der junge Mann vor allem ein großer Film- und Literaturliebhaber, der sein fragiles Selbstbild ständig neu ausrichtet. Als sein Vater ihm einen Wohnungstausch vorschlägt, freundet er sich mit seiner neuen Identität als Hausbesitzer ebenso schnell an wie mit der Idee, einen beinahe Unbekannten mit auf sein nächstes Projekt zu nehmen. Doch die anstehende Reise verläuft nicht wie geplant. Je länger Leon und Janko in Frankreich nach Niemandsorten suchen, desto stärker verwickeln sie sich in einen intellektuellen Machtkampf. Wer, so die alles entscheidende Frage, gewinnt mit seiner Kunst die Deutungshoheit über die Realität - der Journalist oder der Fotograf? Als sich abzuzeichnen beginnt, dass Janko Verrat an der gemeinsamen Sache begehen wird, ist es für Leon längst zu spät, unbeschädigt aus der verhängnisvollen Beziehung zu entkommen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.