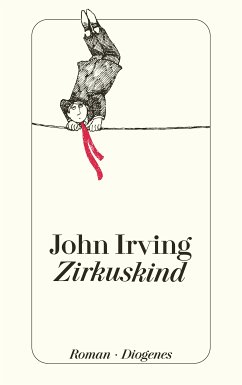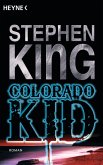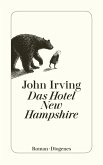Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

John Irving adoptiert ein "Zirkuskind"
Ob es um seinen Erstling "Laßt die Bären los!" ging oder um "Die wilde Geschichte vom Wassertrinker" oder um "Owen Meany" - stets wurde dem Amerikaner John Irving, mittlerweile Mitte Fünfzig, für seine Romane aus unterschiedlichen und oft guten Gründen hohes Lob zuteil. Zu rühmen waren vor allem Irvings Einfallsreichtum und seine erzählerische Urgewalt; und so nimmt es nicht wunder, daß "Zirkuskind", sein neuester Roman, schnell ansehnliche Plazierungen auf den Bestsellerlisten erklomm. Wollte man sich als Spötter in literarischen Angelegenheiten betätigen, so könnte man das alles auch ganz in Ordnung finden - wenn bloß der Text von "Zirkuskind" nicht wäre.
Nach der Lektüre eines knappen Drittels trifft man auf eine Stelle, an welcher der allwissende Erzähler (der nicht als Bestandteil der eigentlichen Handlung in Erscheinung tritt) berichtet, ein Roman sei soeben dabei, die Hauptfigur "zunächst" einzulullen, "wie jeder gute Roman". Bis zu diesem Punkt - und noch ein gutes Stück darüber hinaus - verbreitet Irving vor allem gespreizte Langeweile; und "Zirkuskind" wäre demnach, gemessen an den Ansprüchen seines eigenen Erzählers, kein guter Roman. Zwar läßt sich anhand der restlichen zwei Drittel des Textes partiell verstehen, warum das Ganze etwas zäh in Gang gekommen ist; aber der enttäuschende Gesamteindruck bleibt: Ein ziemlich großer Aufwand ist vertan.
Schon Irvings "Vorbemerkung" weckt den Verdacht, hier solle dem Leser ein Stück Rückversicherungsliteratur schmackhaft gemacht werden. "Zirkuskind" sei zwar kein Buch über Indien, erfährt man, aber "ein Roman, der in Indien spielt - eine Geschichte über einen Inder (aber eben doch keinen Inder), für den Indien immer ein unbekanntes und unergründliches Land bleiben wird". Irvings Sorge bei der Niederschrift galt laut eigener Auskunft seinem Anliegen, "die Details richtig hinzubekommen". Über ebendieser Detailhuberei scheint er (sieht man von einer einigermaßen krude geratenen, aber wenigstens konsequent durchgehaltenen Kriminalgeschichte mit einem transsexuellen Täter ab) den Faden immer wieder zu verlieren. Themen, von denen zu Beginn durch ausgiebige Behandlung suggeriert wird, daß sie für den Roman von Bedeutung sind - etwa die Genetik beziehungsweise die Erforschung von Genen, die für körperliche Anomalien, hier den Minderwuchs, ursächlich sein sollen -, gehen unter in einem zwar kompliziert angelegten, aber letzten Endes nur zu überschaubaren Erzählstrom.
Als Vehikel dient Irving ein Modethema unserer Zeit: das Multikulturelle. Darum fungiert als Protagonist Dr. Farrokh Daruwalla, ein leicht angejahrter indischer Arzt, frühzeitig dank gutsituierter Eltern dem Subkontinent entronnen, ausgebildet in Europa, mit seiner Wiener Ehefrau meist in Toronto lebend und praktizierend. Etwas, das ihm bis kurz vor Schluß des Romans unerklärlich bleibt, zieht ihn immer wieder nach Bombay, seiner Geburtsstadt. Dort unterhält er ein Appartement; dort übt er alle paar Jahre wieder seinen Beruf aus und besucht einen Club, der im Geiste der ehemaligen Kolonialherren betrieben wird. Irving porträtiert seinen Antihelden als sensiblen Zauderer, gezeichnet vom Zwiespalt der Kulturen: nirgendwo heimisch geworden, seinem eigenen Vaterland ebenso entfremdet wie der kanadischen Wahlheimat, in der ihm bisweilen ausländerfeindliche Krawallmacher zusetzen.
Daruwalla entspricht mithin gewissen sentimentalen Vorstellungen, mit denen man in Teilen der westlichen Zivilisation Menschen aus exotischen Ländern betrachtet - sie werden unversehens zu tragischen Figuren, anhand derer der Wohlstandsbürger sein grundsätzlich schlechtes Gewissen in ein erbauliches Selbstwertgefühl ummünzen kann. Umgekehrt bekommt das Personal, das Indien während der erzählten Zeit des Romans (die rund 45 Jahre ab Ende des Zweiten Weltkriegs) aus dem Westen heimsucht, von Irving größtenteils schlechte Noten: naive Touristen; versoffenes, liederliches Filmgesindel; drogendealende Kriminelle. Auf die Spitze treiben möchte Irving das Zwei-Welten-Thema mit der gekünstelt wirkenden Geschichte von den homosexuellen Zwillingen, die, von der Wiege an auseinandergerissen, nach unterschiedlichen Karrieren in Indien und in den Vereinigten Staaten unter Dr. Daruwallas Anleitung doch noch zusammenfinden.
So wie er sich zeitgeistlich abgesegnete Rückversicherungsmöglichkeiten schafft, wird Irving jeden inhaltlich begründeten Zweifel zu entkräften wissen: Nein, es geht nicht um Indien; deshalb wird man ihm nicht mit Detailfehlern kommen können, selbst wenn man welche entdeckt. Nein, das Thema ist nicht die Genetik. Und schließlich: Wer fühlt nicht mit einem braven, tüchtigen, etwas versponnene Weltensohn und Weißkittel - zumal wenn ihm mitten im zivilisierten Kanada rassistische Unholde auflauern?
Was Irving hier offeriert, ist jene Spielart des routinierten amerikanischen Realismus, welche zunehmend ausgelutscht und platt wirkt, stamme sie nun von Paul Auster, von Robert Stone oder von Irving selbst. Letzterer, der lange Zeit zu Recht bewundert wurde wegen seiner sprühenden Phantasie, seiner mitreißenden Sprache, seiner gewagten Bilder, scheint mit "Zirkuskind" endgültig bei der bloßen Ruhmverwertung gelandet zu sein - als Geschäftsmann, der noch einige Bücher dieser Machart wird vermarkten können, bevor ihm sein zahlreiches Publikum dahinterkommt. WOLFGANG STEUHL
John Irving: "Zirkuskind". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Irene Rummler. Diogenes Verlag, Zürich 1995. 970 S., geb., 49,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main