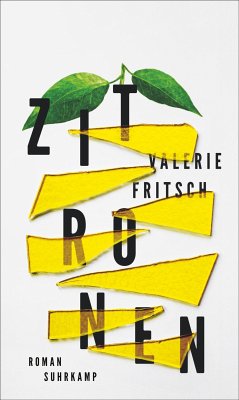Sprachgewaltig, in packenden Bildern und Episoden erzählt Valerie Fritsch in ihrem neuen Roman von der Ungeheuerlichkeit einer Liebe, die hilflos und schwach macht, die den anderen in mentaler und körperlicher Abhängigkeit hält. Ein Entkommen ist nicht vorgesehen, es sei denn um den Preis, selbst schuldig zu werden.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Valerie Fritsch gehört zu den interessantesten Autorinnen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Kann ihr neuer Roman "Zitronen" das einlösen?
Valerie Fritsch zählt - neben Raphaela Edelbauer und Tonio Schachinger - zu den aufstrebenden Stars der österreichischen Gegenwartsliteratur. Schon mit ihrem 2015 erschienenen Roman "Winters Garten" errang sich die gebürtige Grazerin, damals Mitte zwanzig, den Respekt von Kritik und Leserschaft gleichermaßen, gewann beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb sowohl den Kelag- als auch den Publikumspreis. Mit "Herzklappen von Johnson & Johnson" bestätigte sie fünf Jahre später ihren Status als eine vor allem für ihre bildmächtige Sprache gelobte Autorin; abermals landete der Roman, der um Schmerz, Schuld und generationenübergreifende Traumata kreist, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.
Ihr aktueller Roman "Zitronen" nun ist thematisch von seinem Vorgänger nicht weit entfernt. Wieder handelt es sich um einen Familienroman, auch wenn der Vater seinen am Rande eines Dorfes aufwachsenden Sohn recht bald mit dessen Mutter allein lässt - mit der es dieser August Drach freilich auch nicht viel besser getroffen hat. Hatte der gewalttätige, zugleich in sich gekehrte und distanzlose Vater "kein Herz . . ., aber eine Hand", so erweist sich die am Münchhausen- Stellvertreter-Syndrom laborierende Lilly Drach buchstäblich als toxisch. Fürsorglich betüttelt sie ihren vermeintlich physisch fragilen Sohn, dessen kränkelnde Konstitution die ehemalige Krankenpflegerin freilich frei phantasiert beziehungsweise dadurch herbeizuführen sucht, dass sie diesem heimlich einen wüsten Mix an Pharmazeutika ins Essen rührt.
Das Dorf, dessen Einwohner sich suizidieren oder vor Schmerz über ihre spurlos verschwundenen Kinder vergehen, ist eine einzige Ansammlung von Geschlagenen und Gezeichneten, die Drachs selbstverständlich inbegriffen. Lilly macht bereits als Mädchen "Bekanntschaft mit dem Schicksal", und auch der Sohn lernt "die Macht der Kränkung" von Kindesbeinen an. Otto Ziedrich wiederum, "Arzt aus Leidenschaftslosigkeit", hat schon in frühen Dorfjugendjahren "die Abwesenheit von Gott" entdeckt. Er, der August im Auftrag von dessen Mutter behandeln soll und dieser den Hof macht, hätte das Zeug zum Vater, der der leibliche dem Buben nie gewesen ist; aber der Sommerurlaub zu dritt im Lande, wo die Zitronen blühen, bleibt die einzige auch nur annähernd leichte und lichte Episode in dem Elend, das über die Romanfiguren verhängt wurde.
Echte Empathie und geglückte Nähe sind nicht vorgesehen, auch nicht für den inzwischen im Erwachsenendasein und der Stadt angelangten August und die von diesem fiebrig begehrte Ava. "Wer sagte: Du bist mein Leben, meinte auch: Du bist mein Tod", orakelt eine der Sentenzen, die Valerie Fritsch immer wieder einarbeitet, als gälte es, Kissen damit zu besticken. "Wer etwas will, macht Fehler" oder "Zärtlichkeit ist erst in der Dauer wirksam, man glaubt ihr erst beim hundertsten Mal", lauten andere.
Dauerhafte Zärtlichkeit indes lässt der Algorithmus des Romans, in dem alles Kalkül und Kunstwollen ist, nicht zu. Der ist sturheil und wortreich auf Kaputtheit programmiert, und mit jener der Figuren korrespondiert kongenial die der Settings, welche die Autorin an ihrem Schreibtisch im Grand Hotel Abgrund ersonnen hat. Egal ob Stadt, Dorf oder Ferienort, alles ist hier apart angeranzt und abgefuckt, überzogen von einer exquisiten Patina des Ruinösen: "Oft saßen August und Ava . . . auf dem brüchigen Beton der Dachterrasse des Häuserblocks, thronten auf vom Wetter porösen Möbeln zwischen blühenden Satellitenschüsseln oder lungerten auf einem Stoffsofa, das in der Sonne erblasst war." Die Grenze zwischen toter Materie und organischem Leben wird selbst porös, und so kommt es, dass Sofas nicht etwa ver-, sondern erblassen und sich die Figuren selbst, nun ja, "porös" fühlen (ein Adjektiv, für das Fritsch ein besonderes Faible hat).
Der Erzählgestus gibt sich kühl und ungerührt, wenn er August, der eine kurze Zeit seiner beruflichen Laufbahn im Keller der Gerichtsmedizin verbringt, "auf die glatten, augenförmigen Kanäle der Stichwunden, auf die Drosselmarken und Monokel-Hämatome, die Schwellungen ihrer Gesichter, auf die Einblutungen der verfärbten Haut" gewaltsam zu Tode gekommener Menschen blicken lässt, dreht aber ständig heiß, indem er repetitionsselig am eigenen Detachment sich berauscht.
Gewalt lauert in diesem Roman an jeder Ecke, bedroht aber nicht nur dessen Personal, sondern die Sprache selbst, denn hier wird metaphorische Massenkarambolage in Serie produziert. Eine besondere Vorliebe hegt sie für vestimentäre Vergleiche: Da verbringt eine "ein anstrengendes Leben unter dem löchrigen Deckmantel eines unangestrengten Tagesablaufs" und lebt, drei Seiten weiter, "versteckt im Faltenwurf einer unauffälligen Biographie"; da trägt einer "die Gerüche der Gäste in den Kleidern mit sich fort, als hätte er sich ihre Ausdünstungen wie einen Mantel übergeworfen" - ein Bild, das, nun immerhin fünf Seiten später, auf Cinemascope-Format aufgeblasen wird und ungekürzt zitiert zu werden verdient: "Er brauchte den Mantel des Schweigens, der daheim an der Garderobe zwischen den anderen Jacken und Westen hing, benötigte die vier undurchsichtigen Wände des Hauses, die die Welt von ihr fernhielten, und die behauptete Normalität, die ohne Welt in diesem Hause herrschte. Es war die Wohlfühlzone der Gewalt. Er musste seine Fausthiebe und Bauchtritte eingliedern in deren Inneres, unauffällig wie Trödelware zwischen die alten Möbeln stellen, als wäre sie immer schon dagewesen."
Was auch immer das bedeuten soll, eines steht fest: Valerie Fritsch hat es sich in der Wohlfühlzone der Gewalt gemütlich eingerichtet und mit dem sauren Kitsch von "Zitronen" ein Stück Prosa vorgelegt, das an zynischem Kalkül schwer zu überbieten sein dürfte. KLAUS NÜCHTERN
Valerie Fritsch:
"Zitronen". Roman.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2024.
186 S. geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main