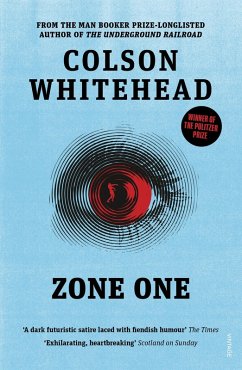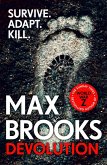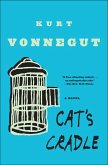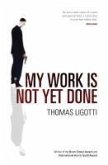A pandemic has devastated the planet, sorting humanity into two types: the uninfected and the infected, the living and the living dead. The worst of the plague is now past, and Manhattan is slowly being resettled. Armed forces have successfully reclaimed the island south of Canal Street - aka 'Zone One' and teams of civilian volunteers are clearing out the remaining infected 'stragglers'.
Mark Spitz is a member of one of these taskforces and over three surreal days he undertakes the mundane mission of malfunctioning zombie removal, the rigours of Post-Apocalyptic Stress Disorder, and attempting to come to terms with a fallen world.
But then things start to go terribly wrong...
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Der amerikanische Autor Colson Whitehead überrascht mit einem Zombie-Roman. Doch man sollte sich nicht täuschen lassen: "Zone One" ist vor allem ein gewitztes Porträt unserer digitalen Gegenwart.
Dass die Gegenwart ein verrätselter Ort ist, dessen Codes sich nicht mehr aufschließen lassen und die Zombies längst unter uns sind, davon erzählt die Pop-Literatur schon seit längerem. Dass nun aber auch der smarte New Yorker Schriftsteller Colson Whitehead sich unter die Zombie-Autoren begeben hat, überrascht auf den ersten Blick. Auf den zweiten aber schon wieder nicht. Denn dass der 1969 geborene Autor eine Vorliebe für alte, eher obskure Science-Fiction-Filme hat, konnte man schon aus seinem Porträt herauslesen, das er vor Jahren über seine Heimatstadt schrieb. Diese hinreißende, hochliterarische Hommage in dreizehn Kapiteln benannte er nach einem klassischen B-Picture "The colossus of New York".
Auch seine anderen Romane, ob sie nun von einer "Fahrstuhlinspektorin" erzählen oder von der Legende um den schwarzen Vorkämpfer "John Henry Days", samt Technikgeschichte und Klassenkampf, oder, wie zuletzt in "Der letzte Sommer auf Long Island", von jenem kleinen Kaff an der Ostküste, an dem die schwarze New Yorker Mittelschicht ihre Sommerfrische verbringt - alle diese Bücher zeigen immer wieder, wie gern sich dieser Autor zwischen skurriler Phantastik und allegorischer Tiefe bewegt.
Und als vor gut zwei Jahren im "New Yorker" nachzulesen war, wie Colson Whitehead die langen Tage seiner Kindheit an der Upper East Side verbracht hat, klärte das im Nachhinein nicht nur, warum der Mann mit den Rastalocken nach seinem Harvard-Studium zunächst Fernsehkritiker bei der "Village Voice" wurde: Während nämlich seine Schulfreunde nach dem Unterricht sofort hinaus in den Central Park zogen, verbrachte er die Nachmittage lieber zu Hause im Wohnzimmer, wo er sich, auf dem Teppich liegend, Horrorfilme anschaute. Freilich verstand der Viertklässler nicht, was er sah, und war überfordert von all dem Unheimlichen. "Eine psychotische Kindheit - Was man von schlechten Filmen lernen kann" nannte er denn auch den Essay im "New Yorker", und er schrieb "Zone One".
Dass der Roman viel mehr mit dem Genre spielt, als dass er sich seinen Regeln unterwerfen würde, versteht sich von selbst. Das Genretypische jedenfalls, all der Horror, die Gewalt, der Krieg, spielt in "Zone One" nicht die tragende Rolle. Colson Whitehead nimmt stattdessen unsere Gegenwart in den Blick, und zwar aus der Perspektive eines Überlebenden. So liest sich "Zone One" nicht nur als Persiflage auf heute, sondern auch, wie schon "Der Koloss", als eine Art Liebeserklärung an New York. Das zeitdiagnostische Experiment nimmt dabei auch den nichtzombie-affinen Leser für sich ein. Und natürlich handelt es sich bei dieser Versuchsanordnung um eine Verneigung vor Richard Mathesons berühmtem Science-Fiction-Roman "I am Legend" von 1954, der Generationen von Autoren prägte und mehrfach verfilmt wurde, zuletzt 2007 mit Will Smith in der Hauptrolle.
In "Zone One" befinden wir uns im New York nach der Apokalypse. Die meisten Menschen haben die Seuche, die vor Jahren über die Menschheit hereinbrach, nicht überlebt. Nur einige wenige Versprengte gibt es noch. Und wenn sie sich in den vermeintlich sicheren Zonen treffen, dann erzählen sie sich anrührende Geschichten von ihrer "letzten Nacht" vor der Katastrophe. Auch Mark Spitz hat überlebt, und er selbst führt das auf seine Durchschnittlichkeit zurück - ein typischer Zweier-Schüler: "Seine Fähigkeiten lagen im geschickten Durchwursteln", heißt es über ihn, "wobei er niemals glänzte und niemals durchrasselte, sondern jeweils nur genau das tat, was erforderlich war, um über das nächste willkürliche Hindernis des Lebens hinwegzukommen."
Obwohl er nicht schwimmen kann, nennt man ihn seit der Katastrophe wie den berühmten Schwimmer, der für Amerika mehr Goldmedaillen gewann als jeder andere. Mark Spitz ist Teil der "Sweeper"-Einheit, die im Auftrag der fernen Regierung in Buffalo New York wieder aufräumen soll, Block für Block. Die Aufgabe ist deshalb so gefährlich, weil Zombies in den leerstehenden Gebäuden ihr Unwesen treiben und jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie haben es darauf abgesehen, Menschen durch Bisse zu infizieren. Und wer von den Sweepern nicht schnell genug zum Gegenmittel greifen kann, der hat schon verloren.
Neben den durchweg bösen Skels gibt es eine weitere, harmlose Variante der Untoten, die sogenannten Irrläufer. Dabei handelt es sich um Menschen, die in der Situation wie schockgefroren wurden. Sie können diesen Moment jedenfalls nicht mehr verlassen und erinnern, wie sie da stumm und bewegungslos stehen, wohl nicht zufällig an die von Lava umgossenen Bewohner Pompejis. Mark Spitz ist jedes Mal gerührt, wenn er bei seinem Marsch durch das südliche Manhattan in voller Kampfmontur wieder auf eine dieser lebenden Skulpturen stößt. Im menschenleeren Supermarkt, am Schreibtisch in der verwüsteten Wohnung.
Natürlich ist "Zone One" eine herrliche Satire auf unsere Gegenwart der digitalen Vielfalt, in der Kaffeemaschinen die Uhrzeiten angeben, Wörterbücher nicht mehr aus Papier bestehen und Familienkameras ihre Koordinaten an erdumkreisende Satelliten senden. Auch die Helden dieser Zukunftswelt rücken nach völlig veränderten Definitionen von Tapferkeit und Einfallsreichtum ins Rampenlicht, und wie Politik funktioniert, wenn es keine Medien und keine Zeitungen mehr gibt, auch das lässt sich hier studieren. Was aber diesen Roman in der Tiefe ausmacht, ist seine überraschende Stille. Denn meist passiert fast nichts, sondern wir lesen, was Mark Spitz durch den Kopf geht, wenn er wieder auf einen Irrläufer stößt oder an eine Straßenecke gerät, die er aus seiner Kindheit kennt. Da trauert Mark Spitz um seine Vergangenheit, die unsere Gegenwart ist. Davon erzählt - Zombies hin oder her - der Sprachkünstler Colson Whitehead, und seine verdichtete Prosa funkelt poetisch wie ein dunkler Stern.
SANDRA KEGEL
Colson Whitehead: "Zone One". Roman.
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Carl Hanser Verlag, München 2014, 304 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main