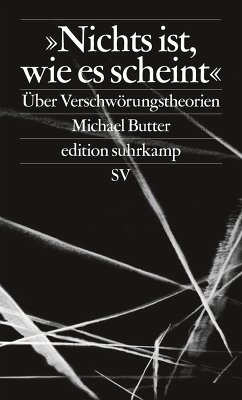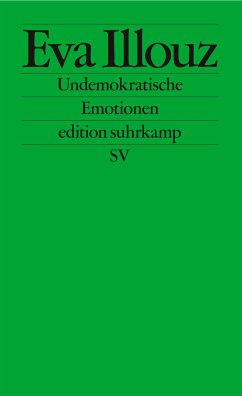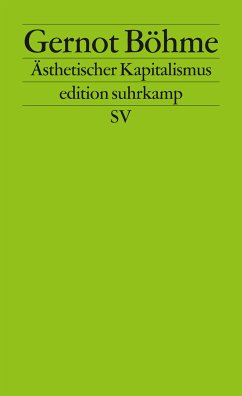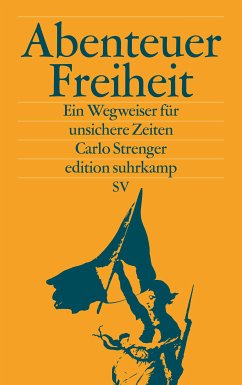Zornpolitik (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 16,00 €**
15,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Gäbe es ein Messgerät für die Intensität kollektiver Gefühle, es würde derzeit Spitzenwerte anzeigen: In den politischen Debatten sind vielerorts Wut, Hass und Angst an die Stelle rationaler Argumente und gegenseitiger Rücksichtnahme getreten. Uffa Jensen verfolgt die Ursprünge der Zornpolitik bis ins 19. Jahrhundert zurück und erläutert, wie solche Gefühle der Ablehnung funktionieren. Dabei wird deutlich, dass Emotionen gerade in Auseinandersetzungen über gesellschaftliche Andere wie Flüchtlinge, Muslime oder Juden hochkochen und bewusst instrumentalisiert werden. Aus den histori...
Gäbe es ein Messgerät für die Intensität kollektiver Gefühle, es würde derzeit Spitzenwerte anzeigen: In den politischen Debatten sind vielerorts Wut, Hass und Angst an die Stelle rationaler Argumente und gegenseitiger Rücksichtnahme getreten. Uffa Jensen verfolgt die Ursprünge der Zornpolitik bis ins 19. Jahrhundert zurück und erläutert, wie solche Gefühle der Ablehnung funktionieren. Dabei wird deutlich, dass Emotionen gerade in Auseinandersetzungen über gesellschaftliche Andere wie Flüchtlinge, Muslime oder Juden hochkochen und bewusst instrumentalisiert werden. Aus den historischen Zusammenhängen zwischen Vorurteilen und Gefühlen leitet Jensen Strategien ab, mit denen wir der aktuellen Welle des politischen Furors begegnen können.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.