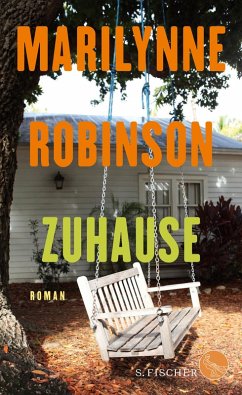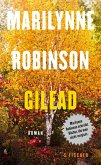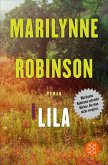Um den erfundenen Ort Gilead hat Marilynne Robinson eine Erzählwelt geschaffen, die Roman für Roman weiterwächst. Gilead ist keine Idylle, sondern eine Stadt, die für den Leser zum Mittelpunkt eines ganzen Kosmos wird. In »Zuhause« kehrt Glory Boughton nach Gilead zurück, um ihren sterbenden Vater zu pflegen. Kurz darauf findet auch ihr Bruder Jack nach 20 Jahren heim, der »Bad Boy« der Familie, der zu viel trinkt und zu wenig tut. Jack eckt bei allen an - und doch ist er der Liebling des Vaters. Allmählich knüpft er ein enges Band zu seiner Schwester, hütet aber weiter ein großes Geheimnis - einen Konflikt aus dem dunklen Amerika, in dem Hautfarbe und Leidenschaft Hass gebären. »Zuhause« ist ein auf leise, präzise Art schonungsloses Buch, in dem Marilynne Robinson die Kontraste ihrer Welt um den fiktiven Ort Gilead noch eindringlicher zeichnet. Sie erzählt mit großer Meisterschaft von Scham und Würde, von Gnade und Vergebung, und wieder gelingt es ihr, dem Trost ein Zuhause zu geben. »Eine unserer größten lebenden Romanautorinnen.« Bryan Appleyard, Sunday Times
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.