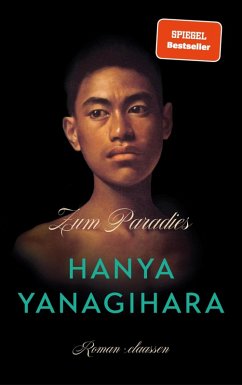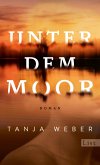Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Vor fünf Jahren machte sie mit "Ein wenig Leben" international Furore. Der Roman spaltete wegen seiner Drastik das Publikum. Jetzt spannt Hanya Yanagihara mit ihrem neuen Amerika-Roman auf wieder fast neunhundert Seiten einen Bogen über drei Jahrhunderte - und uns auf die Folter.
Was hat dieses neunhundertseitige Buch, das den Titel "Zum Paradies" trägt, damit zu tun? Ein Leseparadies ist es schon mal nicht, eher eine bisweilen endlos scheinende Textsteppe gewundener Sätze mit verschachtelten Untergliederungen, die einen oft den Faden verlieren lassen. Eine Parodie des psychologischen Romans, wie bereits vermutet wurde? Auch das würde die Lektüre nicht angenehmer machen.
Oder soll der Ort, an dem die drei Romane spielen, die unter dem Dach dieses Buches zusammengezimmert sind, paradiesisch sein? Sie spielen alle am Washington Square in New York, mithin an einem Ort mit Symbolgeschichte. Hier haben die Vereinigten Staaten zur Selbstfeier ihre Version des Triumphbogens gebaut, hier versammelte sich einst die progressive Folkszene und fand so manche bedeutende Kundgebung oder Protestaktion statt. Zudem gab der Washington Square einem Roman von Henry James seinen Titel und einigen Filmen den Schauplatz, an dem sich etwa Jane Fonda und Robert Redford neckten oder Marvel-Comic-Helden prügelten. Aber im Jahr 2077, so erfahren wir im letzten Teil des Buches von Hanya Yanagihara, kommen Bulldozer und machen die Reste der Bebauung des Washington Square platt, reißen die letzten Bäume aus, und "im übrigen Park gießen Arbeiter den ganzen Tag Bereiche mit Zement aus, die einmal mit Gras bewachsen waren". Kein Paradies also.
Und doch endet jeder der drei Teile programmatisch mit den Worten "Zum Paradies". Dieses Strukturelement unterstreicht, dass Yanagihara drei Varianten einer Geschichte erzählt - nur zu verschiedenen Zeiten: am Ende des neunzehnten Jahrhunderts im ersten Teil, am Ende des zwanzigsten im zweiten und am Ende des einundzwanzigsten im dritten. Auf ihre Weise sind diese Geschichten Märchen, wenn auch sehr lang geratene.
Das erste Märchen, mit dem Titel "Washington Square", ist eines der Liebe und spielt um 1893 in einem New York der kontrafaktischen Geschichtsfiktion: In den sogenannten "Free States" sind gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt und ganz normal. Diese Normalität tritt in Kontrast zur ansonsten konventionellen, ja fast überkandidelt antiquierten Erzählung, in der es "nach Möbelwachs und Lilien" duftet, "nach Earl Grey und Feuer". Aber das Feuer der Liebe lodert dennoch zwischen den Falschen: Denn der wohlhabende Jüngling David Bingham möchte nicht den ihm zugedachten Edelmann Charles heiraten, sondern einen armen Einwanderer namens Edward. Das gefällt dem Großvater nicht, der David zu enterben droht. Am Ende steht der mit gepackten Koffern vor dem "ersten Schritt in ein neues Leben": Er wird mit Edward nach Kalifornien ausbüxen.
Das zweite Märchen, mit dem Titel "Lipo-Wao-Nahele", ist eines der Herkunft und handelt auch von einem David, aber diesmal ist er mit Charles zusammen, dem älteren, reiferen Mann, der 1993 einen Butler hat und mit HIV infiziert ist. Sie leben in einem Männerzirkel voller Luxus und mit einem echten Jasper Johns über dem Sofa, aber das erfüllt David dann doch nicht, der sich immer mehr für seine Vorfahren auf Hawaii interessiert. Dann erzählt über eine sehr lange Strecke Davids im Koma liegender Großvater, den die Romanfiguren nicht hören können, dem die Leser aber zuhören müssen, ein eigenes Märchen von Hawaii.
Erst danach beginnt das dritte Märchen, mit dem Titel "Zone Acht". Es ist das des Abstiegs und noch einmal doppelt so lang wie die beiden davor. In wilden Zeitsprüngen und teils in Form seitenlanger Briefe der Figuren durchmisst es ein weiteres Jahrhundert bis 2094. Dieses Säkulum ist voller Pandemien, voll schlimmer Folgen des Klimawandels, die Welt ist unterteilt in Zonen für Privilegierte und Internierungslager für Kranke und Schwache. Bürger werden überwacht und drangsaliert, alle Grünlandschaft ist Nutzfläche, und die Idee eines "Parks", der zur Erholung dient, in dieser Zukunft gar nicht mehr nachvollziehbar. Die Eichhörnchen hat es schon dahingerafft, die Menschen strampeln noch: Sie geraten hier in die Zwickmühle zwischen Wissenschaft und Humanismus, zwischen Nächstenliebe und Selbsterhaltungstrieb. Das Märchen endet mit dem Brief eines zum Tode Verurteilten, der sich wegwünscht aus einem "verrotteten" New York in ein Paradies namens Neu-Britannien.
Das Paradies ist also immer anderswo: Hanya Yanagihara, die 1974 als Tochter eines Hawaiianers und einer Südkoreanerin in Los Angeles geboren wurde und heute Magazinredakteurin der "New York Times" ist, zielt mit dieser wenig überraschenden Erkenntnis offenbar dezidiert auf die amerikanischen Versprechen, die für viele unverwirklicht geblieben sind. Das ist bei den beschriebenen Einzelthemen ihres Romans durchaus interessant, aber wie sie hier alle zusammengeführt werden, hat doch etwas arg Willkürliches.
Es gibt an Yanagiharas Erzählmittelpunkt auch ein aufschlussreiches Moment der Selbstreferenzialität: In der düsteren Zukunft treten am Washington Square "Geschichtenerzähler" auf, die für Geld unterhalten und belehren sollen. "Verschiedene Geschichtenerzähler erzählten verschiedene Arten von Geschichten. Man ging zu einem, wenn man Liebesgeschichten mochte, und zu einem anderen, wenn man Märchen mochte, und wieder zu einem anderen, wenn man Tiergeschichten mochte, und wieder zu einem anderen, wenn man sich für Geschichte interessierte." Hanya Yanagiharas Anspruch ist offenbar, all dies auf einmal zu leisten. Aber mit ihrer Multifunktionserzählung über Queerness, Kolonialismus und Gesundheitsdiktatur übernimmt sie sich.
Stilistisch ist der Roman wenig reizvoll, es mangelt an sprachlicher Präzision. Ständig werden rhetorische Fragen beantwortet, werden Dinge wiederholt, wird Belangloses episch ausgebreitet. Dann wieder gibt es, wie der folgende Mammutsatz illustrieren mag, auch einen Überschuss an Stil, bei dem man sich aber fragt, zu welchem Zweck eigentlich. Bitte anschnallen: "Und so begann er, Edward mit aufrichtiger Sehnsucht zu befragen, danach, wer er war und wie er dazu gekommen war, dieses Leben zu leben, und als Edward sprach, so natürlich und fließend, als hätte er Jahre darauf gewartet, dass David in sein Leben trat und ihn befragte, wurde David sich, noch während er Edward interessiert zuhörte, bewusst, dass er einen neuen und unangenehmen Stolz empfand - darauf, dass er an diesem unwahrscheinlichen Ort war und dass er mit einem fremden und unwahrscheinlichen Mann sprach und dass er, auch wenn er sehen konnte, dass hinter dem nebelverschmierten Fenster der Himmel schwarz wurde, und auch wenn sein Großvater sich daher zum Abendessen niederlassen und sich fragen würde, wo er war, keine Anstalten machte, sich zu empfehlen, keine Anstalten zu gehen."
Ein interpretatorischer Reiz mag allenfalls darin bestehen, herauszufinden, wer gerade spricht (was oft maximal verunklart wird) oder ob und wie die Figuren der verschiedenen Romanteile miteinander verwandt sind - aber was das eigentlich Literarische angeht, also emotionale Schattierungen, Ambivalenzen oder gar Ironie, ist diese Prosa erstaunlich arm. Von Humor ganz zu schweigen.
Bei Yanagiharas viel gepriesenem und umstrittenem Roman "Ein wenig Leben" (F.A.Z. vom 28. Januar 2017), der ausführlichst vom körperlichen und seelischen Missbrauch an seinem Protagonisten erzählt, hat die Autorin, wie etwa im "Guardian" berichtet wurde, Debatten mit ihrem Lektor darüber geführt, "wie viel ein Leser ertragen kann". Die Frage stellt sich auch angesichts des neuen Buches - hier jedoch nicht in Bezug auf Drastik, sondern nur auf die schiere Länge und frappierende Umständlichkeit der Erzählung. JAN WIELE
Hanya Yanagihara: "Zum Paradies". Roman.
Aus dem Englischen von Stephan Kleiner. Claassen Verlag, Berlin 2022. 896 S., geb., 30,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main