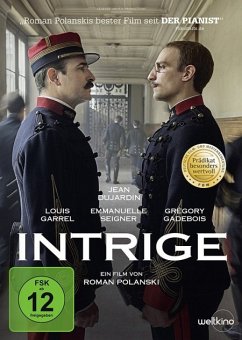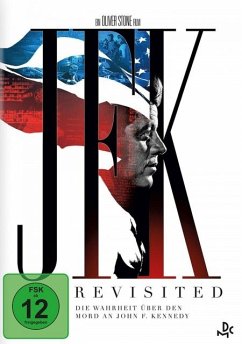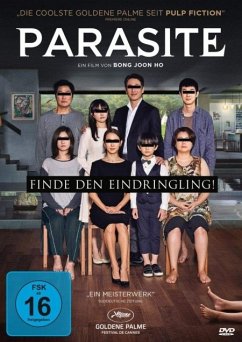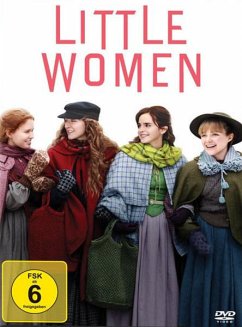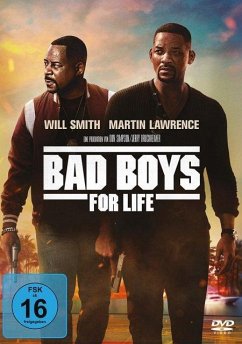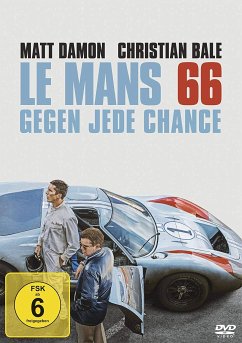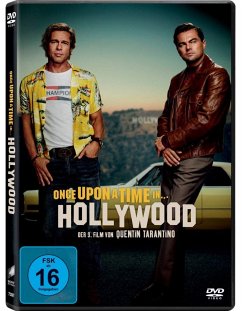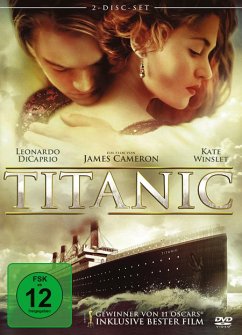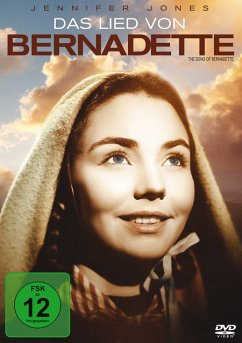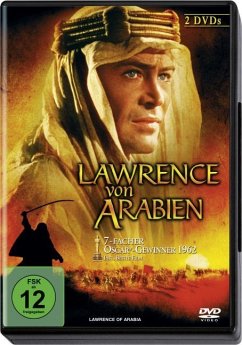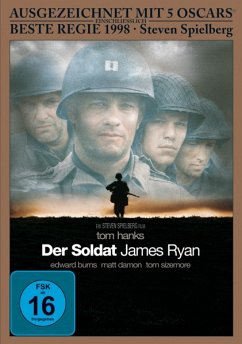1917
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
9,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges sollen die beiden britischen Soldaten Schofield (George MacKay) und Blake (Dean Charles Chapman) eine nahezu unmögliche Mission erfüllen. In einem nervenraubenden Wettlauf gegen die Zeit müssen sie sich tief ins Feindesgebiet wagen und eine Nachricht überbringen, die verhindern soll, dass hunderte ihrer Kameraden in eine tödliche Falle geraten. Eine schmerzlich persönliche Dimension bekommt die ohnehin nervenaufreibende Aufgabe, weil vom Gelingen auch das Leben von Blakes Bruder abhängt.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.